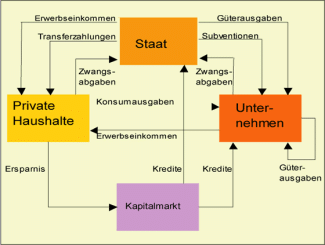Wirtschaftskreislauf
Die Tauschvorgänge innerhalb einer Volkswirtschaft können bildlich als zweiströmiger Kreislauf interpretiert werden (Wirtschaftskreislauf):
- Einerseits fließen zwischen den Wirtschaftssubjekten Zahlungsströme (Geldkreislauf) denen
- andererseits in der Fließrichtung entgegen gesetzte Güterströme gegenüberstehen (Güterkreislauf).
Beide Kreisläufe können als „zwei Seiten derselben Medaille“ betrachtet werden:
- Der Güterkreislauf bildet die Tauschvorgänge von der realwirtschaftlichen Seite her ab: Welche Güter wurden in welchem mengenmäßigen Umfang erworben?
- Der Geldkreislauf beschreibt die Tauschvorgänge von der geldwirtschaftlichen Seite her: Für welche Güter wurden in welchem Umfang Ausgaben getätigt?
Dabei ist der Geldkreislauf statistisch leichter zu erfassen und zu analysieren, weil er alle Transaktionen in derselben Maßeinheit misst (nämlich in Geldeinheiten). Er stellt daher die Grundlage der statistischen Messung der volkswirtschaftlichen Aktivitäten dar, wie sie z. B. in den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen vorgenommen wird.
Betrachtet man den Geldkreislauf, so ist offensichtlich, dass die Abflüsse von Zahlungsmitteln im Gesamtvolumen stets den Zuflüssen entsprechen müssen, denn jede Auszahlung hat einen Empfänger, für den sie Einzahlung ist. Vereinfacht ergibt sich das folgende Beziehungsgeflecht für geldmäßige Transaktionen (insbesondere wird zur Übersichtlichkeit auf die Berücksichtigung von Transaktionen mit dem Ausland verzichtet):
- An die Unternehmen fließen:
– Absatzerlöse aus den Käufen der Güternachfrager (Konsumausgaben der privaten Haushalte, Güterausgaben der Unternehmen und des Staates);
– Kredite zur Investitionsfinanzierung, die letztlich von den (sparenden) privaten Haushalten auf den Kapitalmärkten zur Verfügung gestellt werden;
– Unternehmenssubventionen des Staates.
- An die privaten Haushalte fließen:
– Erwerbseinkommen (Lohn- und Gewinneinkommen) von Seiten der Unternehmen und des Staates;
– staatliche Transferzahlungen (Sozialhilfe, Arbeitslosenunterstützung u. Ä.).
- An den Staat fließen:
– Zwangsabgaben (Steuern, Beiträge, Gebühren) von Seiten der privaten Haushalte und Unternehmen;
– Kredite zur Finanzierung des staatlichen Defizits, die wie die Kredite der Unternehmen auf den Kapitalmärkten aufgenommen werden müssen, auf denen die privaten Haushalte ihre Ersparnisse zur Verfügung stellen.
Damit erhält man im Grundansatz das Strukturbild der wirtschaftlichen Transaktionen (Bild).
Nicht nur werden die gesamtwirtschaftlichen Geldzuflüsse in der Summe den gesamtwirtschaftlichen Geldabflüssen entsprechen, auch die Summe der Geldabflüsse jedes einzelnen Sektors (Unternehmen, private Haushalte und Staat) wird gleich der Summe seiner Geldzuflüsse sein. Daraus ergeben sich folgende so genannte Kreislaufgleichungen:
- Die vom Unternehmenssektor ausgezahlten Erwerbseinkommen (einschließlich Unternehmereinkommen), Güterausgaben (einschließlich Investitionen) und staatlichen Zwangsabgaben entsprechen im Gesamtvolumen der Summe aus Absatzerlösen, (Netto-)Kreditaufnahme und Subventionen des Unternehmenssektors (Kreislaufgleichung des Unternehmenssektors).
- Die Konsumausgaben, die staatlichen Zwangsabgaben und die Ersparnisbildung des Sektors der privaten Haushalte entsprechen im Gesamtvolumen der Summe aus den erzielten Erwerbseinkommen und den empfangenen Transferzahlungen (Kreislaufgleichung des Haushaltssektors).
- Die vom Sektor Staat ausgezahlten Erwerbseinkommen, Güterausgaben, Transferzahlungen und Subventionen entsprechen im Gesamtvolumen der Summe aus Zwangsabgaben und (Netto-)Kreditaufnahme des Staates (Kreislaufgleichung des Staatssektors).
-
Der Wirtschaftskreislauf als Flussdiagramm