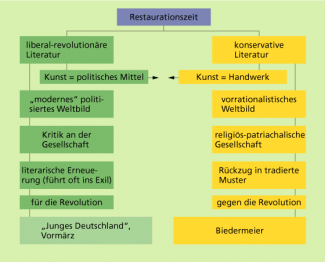Vormärz und Junges Deutschland
Der Vormärz bezeichnet jene Epoche, die literarisch zur deutschen bürgerlichen Revolution von 1848 hinführt und damit ihr Ende findet.
Der Beginn des Vormärz wird in der Literaturgeschichtsschreibung unterschiedlich aufgefasst (1815, 1819, 1830 bzw. 1840).
Zur Literatur des Vormärz werden die Schriften GEORG BÜCHNERs sowie die des Jungen Deutschlands gezählt. Das Junge Deutschland war eine Autorengruppe, die sich an bürgerlich-liberalen Ideen orientierte.
Vormärz meint also die Zeit vor der Märzrevolution 1848.
HEINRICH LAUBE (1806–1884) prägte als erster den Begriff „jungdeutsch“.
Zum Kreis der Jungdeutschen werden außerdem oft
- KARL GUTZKOW (1811–1878),
- LUDOLF WIENBARG (1802–1872),
- LUDWIG BÖRNE (1786–1837),
- FERDINAND FREILIGRATH (1810–1876),
- GEORG WEERTH (1822–1856),
- GEORG HERWEGH (1817–1875),
- AUGUST HEINRICH HOFFMANN VON FALLERSLEBEN (1798–1874),
- THEODOR MUNDT (1808–1861, vgl. PDF 2),
- FERDINAND GUSTAV KÜHNE (1806–1888) und
- ERNST WILLKOMM (1810–1886)
gezählt.
Die Dichter des Vormärz waren radikaler in ihren Ansichten. Ab 1840 nahm die Politisierung des öffentlichen Lebens zu, worauf die Dichter des Vormärz vor allem mit kämpferischer Lyrik reagierten. Zu diesen Dichtern zählt man
- GEORG HERWEGH,
- FRANZ DINGELSTEDT (1814–1881),
- HEINRICH HEINE (1797–1856),
- FERDINAND FREILIGRATH,
- ERNST DRONKE (1822–1891),
- GEORG WEERTH und
- ERNST WILLKOMM.
Geschichtlicher Hintergrund
In Deutschland hatte es nach den Befreiungskriegen keine erhoffte Veränderung der gesellschaftlichen Verhältnisse gegeben. Nach demWiener Kongress 1815 erstarkten die restaurativen Kräfte erneut. Das metternichsche System hatte lediglich einen lockeren Staatenbund geschaffen, der die Souveränität der Einzelstaaten garantierte. Die Herausbildung eines deutschen Nationalstaates mit gleichen Bürgerrechten für alle wurde somit wiederum verhindert.
Die „Heilige Allianz“ zwischen Russland, Österreich und Preußen duldete keine revolutionären und nationalen Regungen in ihren Staaten. Die „Karlsbader Beschlüsse“ von 1819 lösten die berüchtigten „Demagogen“-Verfolgungen aus. Seit
- der Julirevolution in Frankreich 1830,
- dem Hambacher Fest 1832 sowie
- dem Frankfurter Wachensturm 1833
wurden Werke der liberalen Opposition zudem zensiert.
Aufgrund eines Bundestagsbeschlusses von 1835 wurden die Schriften von
- KARL GUTZKOW,
- HEINRICH LAUBE,
- LUDOLF WIENBARG,
- THEODOR MUNDT und
- HEINRICH HEINE
strengster Zensurmaßnahmen unterzogen.
Restauration; spätlat. = Wiedererrichtung der alten politisch-sozialen Ordnung, Rückschrittlichkeit
Zensur; lat. = durch Kirche oder Staat institutionalisierte Kontrollmechanismen zur Steuerung oder Verhinderung gesellschaftlicher Kommunikation.
Zwei Lager innerhalb der Künste
Innerhalb der Künste prägten sich zwei Lager aus. Zum einen diejenigen,die kein Interesse an der Veränderung der politischen Ordnung zeigten (Biedermeier-Autoren), und zum anderen die, die sich nach den Befreiungskriegen eine Verbesserung der Lebensumstände erhofft hatten (Autoren des Jungen Deutschland und des Vormärz).
Eine zeitgenössische Bestandsaufnahme der Literatur um 1830 versuchte WOLFGANG MENZEL mit seinem fünfteiligen Essay „Die literarischen Parteien“ (siehe PDF "Wolfgang Menzel - Die literarischen Parteien").
Die Autoren des Vormärz und des Jungen Deutschland waren sich der Rückständigkeit des deutschen politischen Lebens sehr bewusst. Sie knüpften in ihren politischen Auffassungen nicht an die überkommenen Traditionen an. Vielmehr gaben sie der Hoffnung auf die Veränderbarkeit der gesellschaftlichen Verhältnisse hin zu mehr bürgerlichen Freiheiten literarischen Ausdruck. Das politische Bewusstsein des Volkes sollte wachgerüttelt, die Rechtlosigkeit und Verelendung der Massen beseitigt werden. Vor allem die Forderung nach Gedankenfreiheit spielte eine große Rolle, wurden doch alle Druckerzeugnisse über 20 Bogen der Zensur unterzogen. Auch der Kampf um einen einheitlichen deutschen Nationalstaat stand auf dem Programm der Autoren des Vormärz. Ihre Kritik richtete sich gegen das immer noch bestehende Ständeprinzip des Feudalismus, insbesondere gegen Adel und Klerus. Als in Frankreich die Julirevolution (1830) mit dem „Bürgerkönig“ LOUIS PHILIPPE wieder bürgerliche Kräfte an die Macht brachte, hatte das auf weite Teile Europas nachhaltige Auswirkungen.
PHILIP JAKOB SIEBENPFEIFFER (1781–1845) und JOHANN GEORG AUGUST WIRTH (1798–1848) organisierten 1832 in Deutschland das Hambacher Fest, auf dem die Forderung nach einem Einheitsstaat laut wurde. Mehr als 25 000 Menschen demonstrierten für Freiheitsrechte, Volkssouveränität und ein geeintes Vaterland. Die sozialen Probleme der Massen verschärften sich im Zuge der Industrialisierung immer mehr. 1844 kam es zum verzweifelten Aufstand der schlesischen Weber, der vom Militär blutig niedergeschlagen wurde. HEINRICH HEINE dichtete:
„Das Schiffchen fliegt, der Webstuhl kracht,
Wir weben emsig Tag und Nacht –
Altdeutschland, wir weben dein Leichentuch,
Wir weben, wir weben!“
(Heine, Heinrich: Werke und Briefe in zehn Bänden. Band 2, Berlin und Weimar: Aufbau Verlag, 1972, S, 344)
Die Dichter des Vormärz und des Jungen Deutschland begaben sich auch ästhetisch in eine Gegenhaltung zur deutschen Klassik. LUDWIG BÖRNE (1786 –1837) sagte dazu:
„Seitdem ich fühle, habe ich Goethe gehasst, seit ich denke, weiß ich warum.“
Es ist nicht die künstlerische Leistung, die BÖRNE an GOETHE kritisiert, sondern seine Haltung gegenüber den sozial Unterprivilegierten:
In sein Tagebuch schrieb BÖRNE:
„Dir (d. i. GOETHE) ward ein hoher Geist, hast du je die Niedrigkeit beschämt? Der Himmel gab dir eine Feuerzunge, hast du je das Recht verteidigt? Du hattest ein gutes Schwert, aber du warst immer nur dein eigener Wächter.“
(Börne, Ludwig: Sämtliche Schriften. Bd. 2. Düsseldorf: Melzer-Verlag, 1964, S. 821)
Die Dichter wollten sich aus den überlieferten ästhetischen Formen befreien. Für BÖRNE war die Form gleichzusetzen mit Schönheit. Also musste die Form gesprengt werden. Für BÖRNE war zudem LORD BYRON der ideale Künstler-Mensch. Sich selbst aufgebend hatte BYRON im griechischen Befreiungskampf gegen die Türken mitgewirkt und galt so als Heros für das Junge Deutschland in dem Bestreben, Kunst und Leben für die Freiheit zu geben.
GEORG BÜCHNER (1813–1837) distanzierte sich ausdrücklich vom Jungen Deutschland. In seiner Flugschrift „Der hessische Landbote“ (siehe dort) rief er zum Sturz der alten Ordnung auf: „Friede den Hütten, Krieg den Palästen!“.
Ein wichtiges literarisches Genre wurde der Brief (BÖRNE, HEINE, BETTINA VON ARNIM), der subjektiv, spontan und fragmentarisch auf die Wirklichkeit reagierte. Wie BETTINA VON ARNIM das Genre nutzte, zeigt ihr Briefwechsel mit KAROLINE VON GÜNDERODE (siehe PDF "Bettina von Arnim - Die Günderode").
Suche nach passenden Schlagwörtern
- Junges Deutschland
- Lord Byron
- Befreiungskriege
- Volltext
- JOHANN GEORG AUGUST WIRTH
- HEINRICH LAUBE
- FERDINAND GUSTAV KÜHNE und ERNST WILLKOMM
- PHILIP JAKOB SIEBENPFEIFFER
- Demagogen-Verfolgungen
- Aufstand der schlesischen Weber
- GEORG HERWEGH
- Karlsbader Beschlüsse
- Hambacher Fest
- KARL GUTZKOW
- Wiener Kongress
- Wolfgang Menzel
- Der hessische Landbote
- GEORG WEERTH
- AUGUST HEINRICH HOFFMANN VON FALLERSLEBEN
- FERDINAND FREILIGRATH
- THEODOR MUNDT
- LUDWIG BÖRNE
- Primärtext
- LUDOLF WIENBARG
- BETTINA VON ARNIM
- Frankfurter Wachensturm
- Vormärz
- Quelltext