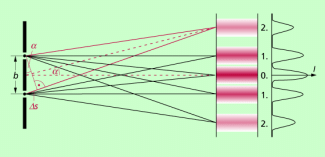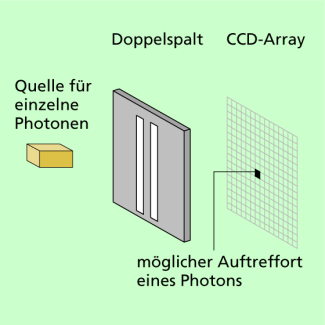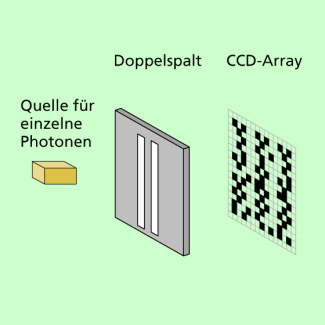Interferenz von Photonen
Schickt man kohärentes Licht durch einen Doppelspalt und bringt man dahinter einen Schirm an, so kann man auf dem Schirm ein typisches Interferenzmuster beobachten. Analoge Experimente kann man auch mit einzelnen Photonen durchführen. Dann zeigt sich:
| Die einzelnen Photonen sind an bestimmten Stellen nachweisbar. | |
| Es gibt Stellen, an denen sich die nachgewiesenen Photonen häufen. | |
| Bei großer Photonenzahl ergibt sich eine Maxima-Minima-Verteilung wie bei Versuchen mit Licht am Doppelspalt oder Gitter. |
Interferenz von Licht am Doppelspalt
Schickt man kohärentes Licht durch einen Doppelspalt und bringt man dahinter einen Schirm an, so kann man auf dem Schirm ein typisches Interferenzmuster beobachten (Bild 1). Die Lage der Interferenzstreifen auf einem Schirm hängt vom Spaltabstand, von der Wellenlänge und vom Abstand Doppelspalt-Schirm ab. Es gilt:
Interferenz einzelner Photonen
In analoger Weise können auch Interferenzexperimente mit einzelnen Photonen durchgeführt werden. Ein einfacher Schirm ist zur Registrierung der Photonen aber nicht geeignet, weil man einzelne Photonen mit den Augen nicht wahrnehmen kann. Eine Lichtsinneszelle im Auge reagiert erst ab etwa 5 Photonen. Man verwendet deshalb spezielle Halbleiterbauelemente. In ihnen wird durch ein Photon ein Elektronen-Loch-Paar hervorgerufen. Durch Verstärkung kann daraus ein messbarer Stromimpuls erzeugt werden. Ein solches Halbleiterbauelement wirkt also als Photonendetektor . Baut man viele solcher Halbleiterbauelemente zusammen, so erhält man ein Feld von Photonendetektoren. Das wird in der Physik auch als CCD-Array bezeichnet, abgeleitet von der englischen Bezeichnung Charge-Compled-Device (ladungsgekoppeltes Halbleiterbauelement). Schickt man einzelne Photonen durch einen Doppelspalt, so kann man die Auftrefforte der einzelnen Photonen registrieren, so wie das in Bild 2 dargestellt ist.
Vergrößert man die Anzahl der Photonen, dann zeigt sich: Es gibt Stellen, an denen besonders viele Photonen nachgewiesen werden können. Das sind genau die Maxima-Stellen, die man bei einem Doppelspaltversuch mit normaler Lichtintensität erhalten würde (Bild 3). Damit kann man formulieren:
Bei Doppelspaltexperimenten sind die Interferenzmaxima die Stellen, an denen nach Durchgang durch den Doppelspalt besonders viele Photonen auftreffen. Die Minima sind die Stellen, an denen besonders wenige Photonen auftreffen.
Insgesamt sind die Photonen statistisch verteilt. Die in Bild 1 dargestellt Intensitätsverteilung auf einem Schirm entspricht im Photonenmodell der Häufigkeitsverteilung der Photonen.