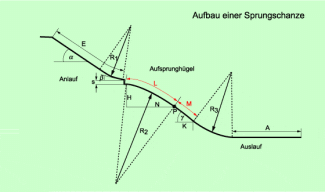Skispringen
Skispringen ist eine Sportart, bei der es darum geht, durch eine hohe Anlaufgeschwindigkeit, einen kräftigen Absprung und eine günstige Flughaltung eine möglichst große Weite zu erreichen.
Physikalisch kann die Bewegung eines Skispringers ab dem Absprung näherungsweise als waagerechter Wurf betrachtet werden. Eine große Rolle spielt aber auch das Luftpolster, auf dem ein Springer „schwebt“.
Skispringen ist eine Sportart, bei der es darum geht, eine möglichst große Weite zu erzielen. Daher versucht der Springer in der Anlaufspur eine möglichst große Geschwindigkeit zu erreichen, kräftig vom Schanzentisch abzuspringen und durch eine geschickte Körperhaltung ein Luftpolster für einen möglichst weiten Flug zu nutzen.
Analyse eines Sprunges
Im Anlauf versucht der Springer eine möglichst hohe Geschwindigkeit zu erzielen. Die maximale Geschwindigkeit, die am Schanzentisch erreicht wird, hängt u. a. von der Anlauflänge, von den Bedingungen in der Anlaufspur, vom Material und von der Körperhaltung des Springers ab. Die erreichten Geschwindigkeiten liegen bei der unten beschriebenen Schanze um 90 km/h.
Am Schanzentisch versucht der Springer möglichst kräftig abzuspringen. Das sollte möglichst nah am Ende des Schanzentisches erfolgen.
Da der Schanzentisch nach unten geneigt ist und der Springer schräg nach vorn abspringt, kann die Bewegung zumindest in ihrer Anfangsphase näherungsweise als waagerechter Wurf angesehen werden.
Nach dem Absprung versucht der Springer möglichst schnell eine solche Haltung einzunehmen, dass er zusammen mit seinen Skiern eine möglichst große Fläche bildet und so auf einem Luftpolster "schwebt". Die Schanze ist so konstruiert, dass sich der Springer während seines Fluges nicht vom Aufsprunghügel entfernt, sondern ihm allmählich näher kommt. Das ist auch eine Frage der Sicherheit.
Die "normalen" Weiten liegen um den Normpunkt herum. Bei größeren Weiten wird eine sichere Landung aufgrund des Bahnverlaufs schwieriger, hinter dem kritischen Punkt K sehr problematisch. Die Sprungweite wird längs des Aufsprunghügels gemessen, wobei der Nullpunkt der Fußpunkt des Schanzentisches ist.
Die durchschnittliche Flugdauer eines Skispringers wird meist überschätzt. Sie beträgt in der Regel 2,5 s bis 3,5 s.
Aufbau einer Sprungschanze
Eine Sprungschanze besteht aus einem Anlauf mit dem Absprungtisch, einem Aufsprunghügel und einem Auslauf (Bild 2). Die folgenden Angaben beziehen sich auf die Sprungschanze in Oberstdorf.
Beim Anlauf beträgt die maximale Anlauflänge E = 82 m. Die Bahn des Anlaufturms hat einen Neigungswinkel von 37°. Der Schanzentisch ist 11,5° nach unten geneigt. Der Radius ist nicht konstant, sondern nimmt zu und beträgt 80 m bis 100 m. Die Höhe des Schanzentisches über dem Aufsprunghügel beträgt 2,5 m.
Der Aufsprunghügel ist bis zum Punkt P, dem Normpunkt, gekrümmt. Der Radius nimmt ebenfalls zu und hat einen Wert von 150 m bis 240 m. Die Aufsprungbahn vom Fußpunkt des Schanzentisches bis zum Normpunkt P ist L = 70 m lang. Anschließend folgt bis zum kritischen Punkt K ein gerades Bahnstück mit einer Länge von M = 15 m. Es hat eine Neigung von 37°, also die gleiche Neigung wie die Bahn des Anlaufturms. Damit ist die gesamte Bahn vom Schanzentisch bis zum kritischen Punkt K ca. 85 m lang. Der Höhenunterschied H zwischen dem Fußpunkt des Schanzentisches und dem Normpunkt P beträgt H = 33,2 m, die entsprechende horizontale Entfernung N = 62,5 m.
Der Auslauf ist gekrümmt und hat einen Radius = 115 m. Er geht in einen geraden Teil A über.
Normalschanzen, Großschanzen und Sprungweiten
Als Normalschanzen werden Sprungschanzen bezeichnet, bei denen die Sprungweiten bis etwa 90 m liegen. Schanzen, die größere Flugweiten ermöglichen, werden als Großschanzen bezeichnet. Einige Anlagen ermöglichen besonders weite Flüge bis zu 200 m. Solche Anlagen nennt man Skiflugschanzen. Die größten Anlagen dieser Art befinden sich in Planica (Slowenien), Bischofshofen (Österreich) und Vikersund (Norwegen). Einige wichtige Meilensteine im Skisprung waren:
- 1936 erreichte der Österreicher Sepp Bradl in Planica erstmals mit 101,5 m eine Sprungweite von über 100 m.
- 1954 stattete der DDR-Trainer Hans Renner eine Schanze in Zella-Mehlis (Thüringen) mit Platten aus, die auch ein Training im Sommer ermöglichten.
- 1987 zeigte der Schwede Jan Bokloev erstmals den V-Stil, den heute alle Springer anwenden.
- 1994 flog der Finne Toni Nieminen als Erster mit 203 m auf über 200 m. Kurz zuvor hatte das auch der Österreicher Andreas Goldberger mit 202 m geschafft, griff aber in den Schnee, sodass dieser Flug als gestürzt galt.
- 2003 erreichte der Finne Matti Hautamäki mit 231 m in Planica einen neuen Weltrekord, der gegenwärtig auch noch gilt.
-
Aufbau einer Sprungschanze