Erste-Hilfe-Maßnahmen bei Knochenbrüchen
Vermutlich kann jeder ein Lied davon singen. Man stolpert und - autsch! -, man hat sich den Fuß verknackst. Er ist verstaucht und man kann kaum auftreten. Gut, wenn man sich dann selbst zu helfen weiß, was als Erstes zu tun ist. Genauso schnell kann man sich unter Umständen einen Knochenbruch zuziehen. Auch hier reicht oft ein Stolpern aus. Doch auch sportliche Betätigungen können eine Verletzung auslösen.
Wichtig ist immer, dass man als Helfer dem Patienten durch die Einleitung der ersten Hilfsmaßnahmen die Schmerzen lindert und verhindert, dass sich die Verletzung durch unnötige Bewegung noch verschlimmert. Hier sind nun einige wichtige Hinweise über Verletzungen am Stützsystem sowie ihre erste Behandlung am Unfallort zusammengetragen.
Unsere Knochen sind tagtäglich großen Belastungen ausgesetzt. Sie tragen unser Gewicht bei allem, was wir tun. Da ist es nicht verwunderlich, dass es immer wieder zu Verletzungen kommt.
Prinzipiell unterscheidet man zwei Arten von Verletzungen an dem aus Knochen, Sehnen und Muskeln bestehendem Stützsystem. Das sind einerseits stumpfe Verletzungen wie Prellungen und Stauchungen und andererseits Knochenbrüche. Es gibt viele Situationen, in denen man sich verletzen kann. Ist es einmal passiert, muss man wissen, wie man sich richtig verhält und am besten helfen kann, um komplizierte Heilungsprozesse oder gar dauerhafte Schäden zu vermeiden.
Verletzungen am Skelett – Knochenbrüche
Es werden drei Arten von Knochenbrüchen unterschieden:
1. Der einfache, geschlossene Bruch
Hierbei handelt es sich um die einfachste und unkomplizierteste Form eines Knochenbruchs. Der Knochen ist einfach, ohne Splitterungen oder Verletzungen nach außen durchgebrochen. In der Erstversorgung wird der betroffene Körperteil ruhig gestellt. Im Krankenhaus richtet der Chirurg den Knochen, damit er gerade zusammenwächst, und legt einen Gipsverband an. Je nach Verlauf des Heilungsprozesses ist der Bruch nach drei bis fünf Wochen verheilt.
2. Der komplizierte geschlossene Bruch
Hier ist der Knochen nicht glatt durchgebrochen. Die Knochenenden sind verschoben und der Knochen deformiert. Zudem haben sich Splitter abgelöst. Die Erstversorgung unterscheidet sich nicht von der bei einem einfachen Bruch, zumal nur der Arzt mittels Röntgenaufnahme beide Brüche voneinander unterscheiden kann. Ein einfacher Gipsverband reicht hier nicht mehr aus. In einer Operation richtet der Chirurg den Knochen und entfernt die Splitter. Wenn nötig wird der Knochen mithilfe von Nägeln und/oder Platten stabilisiert.
3. Der offene Knochenbruch
Das ist die komplizierteste Form der Knochenbrüche. Sie liegt vor, wenn der Bruch durch eine Verletzung der über den Knochen liegenden Gewebeschichten sichtbar ist. Der Bruch steht praktisch mit der Außenwelt in Verbindung. Der Knochen selbst kann sichtbar sein und sogar aus der Wunde herausragen. Die große Gefahr eines offenen Bruches besteht darin, dass durch die Wunde Krankheitserreger eindringen können, die schlimmstenfalls eine schwere Infektion auslösen und so den Heilungsprozess verzögern. In der Erstversorgung ist der Körperteil ruhigzustellen. Anschließend wird die Wunde steril abgedeckt. In einer Operation richtet der Chirurg die Knochen, stabilisiert sie, entfernt Splitter und Verunreinigungen und vernäht Verletzungen der Gewebeschichten. Bis zur Verheilung des Bruches wird der Körperteil ruhig gestellt. Des Weiteren erhält der Patient Antibiotika, um einer möglichen Infektion vorzubeugen.
-
offener Bruch
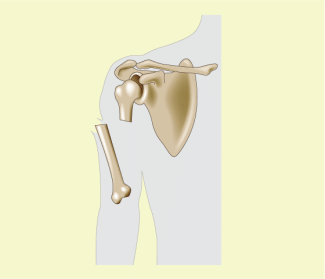
Walther-Maria Scheid
Erste Hilfe bei Knochenbrüchen
Als Erstes, und das gilt für jede Art von Unfall und Verletzung, muss der Verletzte aus möglichen Gefahrensituationen entfernt werden. Als Nächstes wird kontrolliert, ob der Verletzte ansprechbar ist. Das ist sehr wichtig, da bei jeder Verletzung und bei jedem Unfall ein Schock entstehen kann, und der Verletzte bedarf auch in dieser Hinsicht unbedingt sofortiger Betreuung. Das bedeutet, dass der Verletzte gegen Unterkühlung geschützt und sein Kreislauf möglicherweise stabilisiert werden muss. Gegen Auskühlung hilft eine Decke oder die Jacke eines Helfers. Kreislaufprobleme erkennt man daran, dass der Verletzte sehr blass ist. Auf seiner Haut hat sich kalter Schweiß gebildet und oft klagt er auch über Schwindelgefühle. Bei solchen Symptomen sind die Beine hochzulagern (Schocklagerung). Dadurch fließt das Blut aus den Beinen zurück in den Körper und die Sauerstoffversorgung im Kopf wird erleichtert.
Ein Schock muss immer als Erstes versorgt werden, da er lebensbedrohliche Ausmaße annehmen kann.
Im schlimmsten Fall führt ein Schock zu Kreislaufversagen und, wenn er nicht rechtzeitig behandelt, wird zum Tod.
Erst wenn ein möglicher Schock behandelt ist, wenden wir uns dem Knochenbruch zu. Vermutet man einen Knochenbruch, so wird der betroffene Körperteil, meist sind es Arme und Beine, ruhig gestellt. Hierzu legt man Schienenverbände an. Geeignet sind alle zur Verfügung stehenden Materialien, also Holzplatten, Leisten, Stöcke, gerollte Wolldecken usw. Ist das Schienenmaterial sehr hart, so muss es mit sauberen Tüchern, Zellstoff oder Watte gepolstert werden. Die Schienen werden so angelegt, dass bei Gliedmaßen auch die beiden benachbarten Gelenke mit ruhiggestellt werden. Dadurch wird ein Verschieben der Knochenenden verhindert. Hat man die Schiene an den betroffenen Körperteil angelegt, wird sie mittels Bandagen (Binden, Dreieckstücher, Krawatten, Gürtel, Stoffstreifen usw.) festgebunden.
Bei offenen Brüchen werden die Gliedmaßen ebenso ruhiggestellt. Allerdings ist hier ein weiterer Schritt notwendig. Die Wunde muss steril abgedeckt werden. Ragt der Knochen heraus, so wird er über der sterilen Abdeckung mit Mullbinden abgepolstert. Doch Vorsicht, dabei darf kein Druck ausgeübt werden. Es kann jedoch vorkommen, dass durch den Bruch eine Arterie verletzt ist. Das erkennt man daran, dass intervallartig Blut aus der Wunde spritzt. Ist das der Fall, so muss der Körperteil oberhalb der Wunde, also zum Körper hin, abgebunden werden. Nur so kann ein Verbluten verhindert werden.
Nach der Erstversorgung am Unfallort ist in jedem Fall der Arzt aufzusuchen bzw. zu benachrichtigen. Im Krankenhaus werden dann alle weiteren notwendigen Behandlungsschritte eingeleitet.
Woran erkennt man die verschiedenen Knochenbrüche?
1. Armbruch:
Eindeutige Bruchzeichen sind:
- Verformung
- Abnorme Beweglichkeit und Knochenreiben
Nicht eindeutige Bruchzeichen sind:
- Starke Schmerzen
- Gebrauchsuntüchtigkeit
- Bluterguss
Maßnahmen:
- Arm ruhigstellen
- beim Oberarmbruch muss die gepolsterte Schiene bis über die Schulter reichen.
- Anschließend Fixierung mit Armschlinge/Dreieckstuch
- Wenn nötig, Oberarm am Brustkorb fixieren.
2. Beckenbruch
- Bein- und Beckenbewegung nur unter starken Schmerzen möglich.
- Blutergüsse in der Beckengegend.
Besonderheiten:
Verletzungen von Harnblase bzw. Harnröhre möglich. Sichere Zeichen hierfür sind Schmerzen beim Wasserlassen, blutiger Urin, Blasendruck
Maßnahmen:
- Wunden sofort steril abdecken
- Verletzten in ein festes Leinentuch wickeln, mit kräftigen Sicherheitsnadeln feststecken, um eine Drehung des verletzten Beckens zu verhindern.
3. Beinbruch
Besonderheiten:
- Unterschenkel bestehen aus zwei Knochen. Es müssen nicht beide gebrochen sein.
- Bein vor Transport schienen, dabei kann das unverletzte Bein auch als Schiene dienen.
4. Kieferbruch
Kennzeichen:
- Schwellung
- Schmerzen
- Einschränkung der Bewegungsfähigkeit
- Veränderter Zahnschluss
Maßnahme:
- Unterkiefer am Kopf fixieren
5. Kniescheibenbruch
Es ist unmöglich, das Bein zu strecken.
6. Nasenbeinbruch
Kennzeichen:
- Nase ist verformt
- Nasenbluten
- Heftige Schmerzen
- Starke Schwellung
Maßnahme:
- kühle Umschläge und sofort zum Arzt
7. Rippenbruch
Kennzeichen:
- Atemprobleme mit stechendem Schmerz beim Atmen
Maßnahme:
- Linderung verschafft fester Verband um den Brustkorb. Dazu den Patienten so tief wie möglich Luft holen lassen und nach dem Ausatmen den Verband anlegen.
Risiko:
- Eine Rippe kann die Lunge verletzt haben. Kennzeichen hierfür sind Reizhusten mit rötlich-schaumigem Auswurf.
- Der Patient muss sofort in sitzender Stellung ins Krankenhaus gebracht werden. Es besteht Lebensgefahr.
8. Schädelbruch, Schädelbasisbruch
Kennzeichen:
- Blutungen aus Nase, Mund und Ohren
- Allmähliche Ausbildung eines Blutergusses um beide Augen
- Mögliche Bewusstseinstrübungen / Desorientierung
- Benommenheit
- Bewusstlosigkeit
- Krämpfe
Risiko:
Es kann zu plötzlicher Bewusstlosigkeit kommen mit Atem- und Herzstillstand.
Maßnahmen:
- Umgehend Arzt benachrichtigen
- Patienten beobachten, möglichst in stabiler Seitenlage lagern
- Beatmung bei Atemstillstand
- Offene Wunden steril abdecken
9. Schlüsselbeinbruch
Kennzeichen:
- Arm der betroffenen Seite hängt schlaff herab
- Armtragetuch um den Arm legen. Zwei Dreieckstücher dienen der Fixierung am Körper.
- Polster unter die Achsel legen, dient der Entlastung des Bruches
10. Wirbelbruch
Kennzeichen:
- Taubheit und Kribbeln in Armen und Beinen
- Bewegungsunfähigkeit
Maßnahmen:
- Verletzten absolut ruhig lagern. Jede Bewegung ist verboten.
- Lockerung beengender Kleidung
- Kopf nicht anheben
- Keine Getränke geben
Risiko:
- Druck oder Bewegung können Lähmungen verursachen, schlimmstenfalls zum Tod führen. Es besteht Lebensgefahr!
- Transport durch Arzt bzw. Rettungskräfte auf harter Unterlage. Verletzten nur so viel wie unbedingt notwendig bewegen.
11. Zehenbruch
Kennzeichen:
- Schwellung
- Schmerzen
- Verminderte Bewegungsfähigkeit
- Mögliche Quetschungen und offenen Wunden
Maßnahmen:
- Offene Wunden steril verbinden
- Fuß mittels Behelfsschiene ruhigstellen
Wie meldet man einen Notfall?
Es ist sehr wichtig in einer Notsituation, in der andere Menschen Verletzungen erleiden, zu wissen, was zu tun ist. In einem Erste-Hilfe-Kurs kann man lernen, wie die Erstversorgung eines Verletzten auszusehen hat. Aber auch ohne Erste-Hilfe-Kurs sollte jeder in der Lage sein, zu wissen, wie man einen Notfall meldet. Denn schon durch schnelles und besonnenes Reagieren kann man Menschenleben retten. Die Notrufnummer in Deutschland ist 110 oder 112. Eine optimale Notfallmeldung sollte in jedem Fall die 5 W enthalten:
- Wo ist es passiert? (je genauer die Ortsangabe ist, umso schneller kann der Notarzt dort sein)
- Was ist passiert?
- Wann ist es passiert?
- Welche Verletzungen?
- Wer meldet den Unfall?

