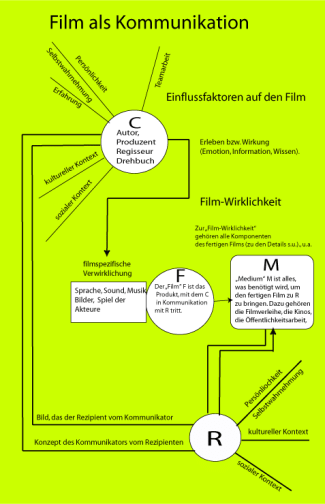Filmanalyse
Wenn wir einen Film anschauen, erleben wir ihn als Ganzheit und lassen uns – unserem Erfahrungshorizont entsprechend – auf die Welt der Bilder und Töne ein. Wir können der Handlung folgen, ohne nachzudenken. Sind Sie nun im Unterricht vor die Aufgabe gestellt, einen Film oder eine Filmsequenz zu analysieren, so geht es um die Abschätzung der filmischen Absicht und um die Analyse der filmischen Mittel.
Ausgangspunkt bei der Filmanalyse ist in der Regel eine formal-inhaltliche Protokollierung des filmischen Ablaufs. In der Praxis haben sich folgende Schritte für eine exemplarische Filmanalyse als sinnvoll erwiesen:
- Inhaltsbeschreibung
- Problematisierung und Fragestellung
- Bestandsaufnahme mit Sequenzbeschreibungen
- Analyse und Interpretation unter Einbeziehung des
- historisch-gesellschaftlichen Kontexts
- Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse
Bei der Filmanalyse, die sich häufig auf einzelne Sequenzen konzentriert, interessiert uns das Aufschlüsseln von Elementen der Filmregie wie:
- Einstellung,
- Kameraperspektive,
- Kamerabewegung,
- Licht,
- Ton,
- Montage.
Die beigefügte Grafik illustriert das komplexe Wirkungsgefüge von Produktions-, Film- und Wirkungsrealität und gibt Anhaltspunkte für ein systematisches Vorgehen bei der Filmanalyse.
Hinweise zur Grafik:
In Anlehnung an KORTE (1993) werden die drei „ Realitätsebenen “ der filmischen Kommunikation unterschieden in:
- „Produktions-Wirklichkeit“,
- „Film-Wirklichkeit“ und
- „Rezeptions-Wirklichkeit“.
Die „ Produktions-Wirklichkeit “ umfasst all die (Einfluss)-faktoren auf die und in der Produktion des jeweiligen Films(zu den Details s.u.).
Bei der filmischen Kommunikation tritt der „Communicator“ C in einen Kommunikationskontakt mit einem Rezipienten (R) und löst bei ihm ein Erleben bzw. eine Wirkung aus ( Emotion, Information, Wissen). Da Filme im Normalfall das Ergebnis der Zusammenarbeit vieler Spezialisten sind, fällt es häufig nicht leicht, C genau zu identifizieren. Ist der Autor, dessen Buch verfilmt wird, auch als ein Teil von C zu sehen? Welche Rolle spielen die Drehbuchautoren, welche die Schauspieler und die Produzenten? Diese Fragen sind i.d.R. nicht im Detail zu beantworten. Unstrittig dürfte jedoch bei den allermeisten Filmen die wichtige Rolle des Regisseurs als C sein. Inwieweit das auch bei an Fließbandproduktion erinnernden Fernsehserien so ist, ist eine weitere schwer zu beantwortende Frage.
Zur „ Film-Wirklichkeit “ gehören alle Komponenten des fertigen Films:
Bei der Analyse der „Film-Wirklichkeit“ geht es um die möglichst vollständige Erfassung und Bewertung aller im fertigen Film auffindbaren Informationen. Dabei sind sowohl die im Filmkapitel wie auch die folgenden gegebenen Kategorien behilflich, wenn man die Analyse u.a. fokussiert auf:
- die in den Einzelbildern, bzw. den Einstellungen gemachten Aussagen, d.h. Bildinhalt, Bildgestaltung und Bild- und Einstellungsinszenierung;
- die gesprochenen Texte (insbesondere Dialoge)
- die eingesetzte Musik, die Töne und Geräusche;
- die inhaltliche Struktur des Films („Plot“ (Handlungsverlauf), Charaktere, Handlungsorte, -zeit;
- den Schnitt und die damit verbundene Montage der „Shots“);
- das Schauspielen;
Zur „ Rezeptions-Wirklichkeit “ gehören die Wirkungen des Films auf den Rezipienten R. „Produktions-Wirklichkeit“ und „Film-Wirklichkeit“ bleiben folgenlos, wenn keine „Rezeptions-Wirklichkeit“, d.h. eine Wahrnehmung und Verarbeitung des Films durch R, dazukommt. Bei der Analyse dieser Realitätsebene sind folgende Aspekte zu berücksichtigen.
- die in der Persönlichkeit und der Selbstwahrnehmung Einflussfaktoren, wie Vorwissen, politische Orientierung, etc., auf das Verstehen und die Wirkung des Films beim Rezipienten;
- die dabei zum Tragen kommenden Faktoren des „kulturelle Kontext“
- der „soziale Kontext“ des Rezipienten (Welcher Film ist ‚in'?)
- der Publikumserfolg (Besucherzahlen, etc.);
- die Rezeption zur Entstehungszeit des Films (zeitgenössische Rezeption, durch professionelle Kritiker und das ‚normale' Publikum);
- die heutige Rezeption.
Für die Erklärung des Erfolgs oder Misserfolgs eines Films kann eine, wiederum häufig spekulative, nähere Betrachtung des Bildes, das der Rezipient vom Kommunikator hat, beitragen. Dieses Bild ist in der Regel von Vorerfahrungen mit dessen anderen Filmen geprägt und beeinflusst nicht unwesentlich die Auswahl bestimmter Filme durch den Rezipienten.