Partielle Ableitungen
Für eine Funktion mit einer Gleichung , also für eine Funktion mit genau einer unabhängigen Variablen x, ist die erste Ableitung an einer Stelle erklärt durch den Grenzwert des Differenzenquotienten an dieser Stelle:
Interpretiert man diesen Grenzwert geometrisch, so gibt er den Anstieg der Tangente an den Graphen von f im Punkte an.
Es sei nun die Gleichung einer Funktion f mit zwei unabhängigen Variablen x und y. Betrachtet man diese Funktion für ein konstantes , so erhält man eine Funktion mit nunmehr nur einer unabhängigen Variablen x, für die man wie oben angegeben den Grenzwert des Differenzenquotienten an einer Stelle aufstellen kann. Existiert dieser Grenzwert, so nennt man ihn die partielle Ableitung erster Ordnung der Ausgangsfunktion nach x an der Stelle und schreibt:
Betrachtet man analog die Funktion f für ein konstantes , so erhält man jetzt eine Funktion mit der unabhängigen Variablen y. Den Grenzwert
nennt man ihn die partielle Ableitung erster Ordnung der Ausgangsfunktion nach y an der Stelle .
Zusammenfassung:
Ist eine Funktion für ein konstantes an einer Stelle differenzierbar, so heißt dort partiell nach x differenzierbar. Die dazugehörige Ableitung wird partielle Ableitung von f nach x an der Stelle genannt.
Entsprechend heißt die Funktion partiell nach y differenzierbar, wenn sie für ein konstantes an einer Stelle nach y differenzierbar ist. Die dazugehörige Ableitung wird partielle Ableitung von f nach y an der Stelle genannt.
Anmerkungen:
Ist die Funktion für jedes x bzw. y des Definitionsbereichs partiell nach x bzw. y differenzierbar, so spricht man schlechthin von den partiellen Ableitungen nach x bzw. y und schreibt bzw. .
In Analogie zu schreibt man für bzw. auch
und spricht von der partiellen Ableitung von f nach x bzw. von f nach y.
Für die Bildung der partiellen Ableitungen erster Ordnung lassen sich sämtliche Ableitungsregeln einer Funktion mit einer unabhängigen Variablen übertragen, wenn man jeweils beachtet, welche Variable im betreffenden Zusammenhang die unabhängige ist.
Beispiel 1: Gesucht sind die partiellen Ableitungen der Funktion
y wird als konstant angesehen:
x wird als konstant angesehen:
Beispiel 2: Gesucht sind die partiellen Ableitungen der Funktion
y wird als konstant angesehen – wir erhalten eine Potenzfunktion:
x wird als konstant angesehen – wir erhalten eine Exponentialfunktion: .
Geometrische Deutung der partiellen Ableitung
Eine Funktion von zwei Variablen beschreibt im Allgemeinen eine Fläche im Raum.
-
Geometrische Deutung der partiellen Ableitung
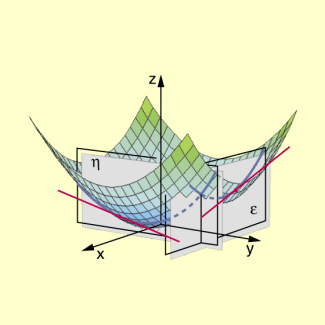
Durch die Annahme werden alle die Punkte der betreffenden Fläche herausgegriffen, die zugleich in der zur xz-Ebene parallelen Ebene mit liegen. Diese Punkte bilden eine Kurve , die als Schnittkurve der Ebene und der Fläche gedeutet werden kann. Der Anstieg der Tangente an diese Schnittkurve wird durch die partielle Ableitung beschrieben. Entsprechend liefert die Annahme eine zur yz-Ebene parallele Ebene, welche die Fläche in der Kurve schneidet. Die partielle Ableitung gibt den Anstieg der Tangente an diese Schnittkurve an.
Beispiel 3: Der Graph der Funktion stellt ein Rotationsparaboloid dar. Es entsteht durch Rotation der Parabel um die z-Achse.
-
Geometrische Deutung der partiellen Ableitung am Beispiel (Rotationsparaboloid)
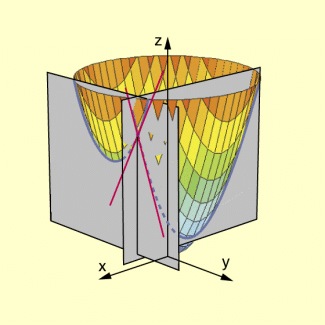
Die partiellen Ableitungen lauten:
Mit ihrer Hilfe kann man nun die Anstiege der Tangenten in einem Punkt berechnen.
So erhält man für die partiellen Ableitungen
.
Die im Punkt zur xz-Ebene parallele Tangente hat also einen Anstieg von 2, die im selben Punkt zur yz-Ebene parallele Tangente hat den Anstieg 4.
Gradientenvektor
Die partiellen Ableitungen erster Ordnung einer Funktion fasst man im sogenannten Gradientenvektor zusammen und schreibt
.
Für obiges Beispiel des Rotationsparaboloids würde der Gradientenvektor also folgendermaßen lauten
Der Gradientenvektor ordnet somit jeder Stelle des Definitionsbereichs von einen Vektor zu, der folgende Eigenschaften besitzt:
- Ausgehend vom Punkt zeigt der Gradientenvektor in Richtung des steilsten Anstiegs in der Fläche .
- Der durch den Gradientenvektor beschriebene Vektor ( Gradient ) steht senkrecht auf der durch verlaufenden Höhenlinie von .
- Der Betrag des Gradienten ist der Wert der Steigung in Gradientenrichtung.

