Lärm und Lärmbekämpfung
Schall, der als belästigend empfunden wird oder gar zu gesundheitlichen Schäden führen kann, wird als Lärm bezeichnet. Die stärkste Lärmquelle ist bei uns der Straßenverkehr. Lärm kann den menschlichen Körper stark beeinflussen und zu körperlichen Schäden führen.
Die Vermeidung von Lärm ist der beste Lärmschutz. Wo Lärm unvermeidlich ist, sollte er gedämpft oder gedämmt werden.
Schall, der an unsere Ohren gelangt, kann bei uns angenehme Empfindungen auslösen, z. B. die Sprache von vertrauten Menschen, Musik oder das knisternde Geräusch eines Lagerfeuers. Schall kann uns aber auch stören, belästigen oder sogar schädigen.
Schall, der als belästigend empfunden wird oder gar zu gesundheitlichen Schäden führen kann, wird als Lärm bezeichnet.
Dabei ist zu beachten: Lärm ist eine subjektive Empfindung. Das, was der eine als Lärm empfindet, muss ein anderer nicht zwangsläufig auch als Lärm empfinden. Lärm ist keine Erscheinung unserer Zeit, sondern hat schon immer Menschen beschäftigt. So bestimmte z. B. das Allgemeine Preußische Landrecht von 1793:
"Mutwillige Buben, welche auf den Straßen lärmen, sollen mit verhältnismäßigem Gefängnis, körperlicher Züchtigung oder Zuchthaus bestraft werden."
Unbestritten ist, dass die uns umgebende Welt lauter geworden ist: Autos, Motorräder, Flugzeuge, Radios, CD-Player und Fernsehgeräte tragen ebenso zum Lärm bei wie Rockkonzerte oder Diskotheken. Etwa 25 Millionen Bürger der Bundesrepublik Deutschland, das sind ca. 40 %, fühlen sich zeitweise oder dauernd durch Lärm belästigt.
-
Der Straßenverkehr ist die Hauptquelle des Lärms

L. Meyer, Potsdam
Die wichtigsten Lärmquellen
Die wichtigsten Lärmquellen sind der Lärm des Straßenverkehrs. Das hängt damit zusammen, dass sich in den letzten Jahrzehnten die Anzahl der Kraftfahrzeuge vervielfacht hat. 1950 gab es in der Bundesrepublik ca. 2 Millionen Kraftfahrzeuge. 1986 waren es 31 Millionen und 1995 bereits 40 Millionen. Diese Anzahl erhöht sich weiter. Den größten Lärm verursachen Mopeds, Motorräder und LKW. Hinzu kommen in vielen Gebieten Lärm des Schienenverkehrs und Fluglärm sowie der Lärm von Maschinen und Anlagen der unterschiedlichsten Art. Eine weitere wichtige Lärmquelle liegt im häuslichen Bereich: Laute Gespräche, Radios oder Fernsehgeräte weit über der Zimmerlautstärke führen ebenfalls zur Lärmbelästigung. Einen Überblick über die Lärmbelästigung gibt Bild 2. Dargestellt sind Befragungsergebnisse zur Belästigung der Bevölkerung durch Lärm, wobei Mehrfachnennungen möglich waren.
-
Befragungsergebnisse zur Lärmbelastung
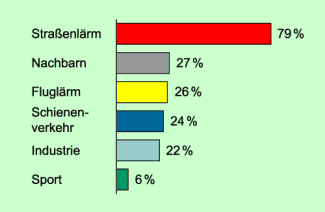
Messung von Lärm
Schall bereitet sich als Druckwelle in der Luft aus. Wir nehmen ihn nur dann wahr, wenn er oberhalb der Hörschwelle und unterhalb der Schmerzschwelle liegt. Gemessen wird der Schallpegel - subjektiv als Lautstärke empfunden - in Dezibel (dB). Die Hörschwelle liegt bei 0 dB, die Schmerzschwelle bei 130 dB. Gemessen werden kann der Schallpegel mit Schallpegelmessern.
Wirkungen von Lärm
Die Wirkungen von Lärm sind sehr unterschiedlich. Dauerhafter und starker Lärm, aber auch kurzzeitiger sehr intensiver Lärm kann den menschlichen Körper stark beeinflussen und zu gesundheitlichen Schäden führen. So kann es durch Lärm zu einer Erhöhung des Blutdruckes, zu einer Beschleunigung der Atmung sowie zu einer Erhöhung der Herzfrequenz kommen. Es können Schlafstörungen, eine Minderung der Konzentrationsfähigkeit sowie Kopf- und Magenschmerzen auftreten. Medizinisch nachweisbar sind Veränderungen der Gehirnaktivität und der Durchblutung sowie das Ausscheiden von Stresshormonen.
Wenn man sich längere Zeit stärkerem Lärm aussetzt, kann auch das Gehör geschädigt werden. Es tritt dann Lärmschwerhörigkeit auf. Jedes menschliche Ohr enthält etwa 20 000 Sinneszellen (Haarzellen), die die ankommenden Schallwellen in elektrische Signale umwandeln, die ihrerseits zum Gehirn geleitet werden und dort die Hörempfindung auslösen. Diese Sinneszellen werden durch Lärm beinflusst.
Kurzzeitiger Lärm verringert ihre Leistungsfähigkeit zeitweise. Es kommt zu einer vorübergehenden Betäubung. Länger anhaltender stärkerer Lärm von über 85 dB führt zu einem allmählichen Absterben von Haarzellen. Da sich diese Zellen nicht regenerieren, entsteht dadurch ein bleibender Hörschaden, der im Extremfall bis zur Taubheit führen kann. Als Grundsatz sollte deshalb für jeden gelten:
Die Vermeidung von Lärm ist der beste Schutz vor gesundheitlichen Schäden. Wo es möglich ist, sollte Lärm gedämpft oder gedämmt werden.
Schutz vor Lärm
Lärmschutz ist darauf gerichtet, schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm auf den Menschen zu vermeiden oder zumindest abzuschwächen. Am besten wäre es natürlich, die Entstehung von Lärm zu vermeiden. Wo das nicht möglich ist, muss der Lärm durch verschiedene Maßnahmen gedämpft und gedämmt werden.
![]()
Da der Straßenverkehr die wichtigste Lärmquelle ist, werden seit geraumer Zeit Grenzwerte für Straßenfahrzeuge festgelegt. Die innerhalb der Europäischen Gemeinschaft einheitlichen Grenzwerte sind in Bild 4 dargestellt. Die rot eingezeichneten Werte galten bis 1889, die blau eingezeichneten zwischen 1989 und 1995 und die grün eingezeichneten ab 1995.
Darüber hinaus gibt es eine Vielzahl von technischen Maßnahmen, die auf die Lärmbekämpfung gerichtet sind. Dabei wird genutzt, dass Schall an glatten Flächen gut reflektiert und von porösen Flächen gut absorbiert wird.
-
EG-Geräuschgrenzwerte für verschiedene Fahrzeuge
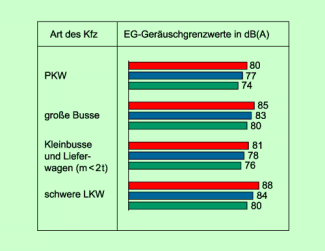
Zu solchen Maßnahmen des Lärmschutzes gehören:
- die Errichtung von Schallschutzwänden oder Erddämmen an Straßen,
- der Einbau von Schallschutzfenstern und schalldämmenden Materialien in Gebäuden,
- die Kapselung von Fahrzeugmotoren und die schalldämmende Auskleidung von Motorräumen,
- die Verminderung der Reifen-Fahrbahngeräusche durch Verbesserung der Reifen und Veränderung des Straßenbelages (Flüsterasphalt),
- die zunehmende Nutzung von Flugzeugen mit relativ leisen Triebwerken,
- der Bau leiserer Maschinen und Anlagen (Rasenmäher, Staubsauger, Waschmaschinen usw.).
An Stellen, wo sich Lärm weder vermeiden noch dämmen lässt, ist es mitunter erforderlich, durch Gehörschutz (spezielle Kopfhörer) gesundheitliche Schäden zu vermeiden. Notwendig ist das z. B. bei der Einweisung von Flugzeugen auf Flugplätzen oder beim Arbeiten mit einem Presslufthammer.
-
Schallschutzwand an einer Autobahn

K. Bahro, Berlin

