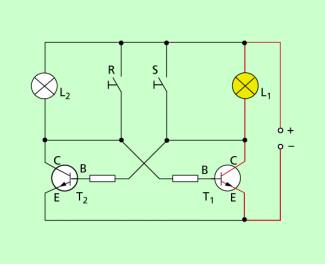Flip-Flop-Schaltung
Bei einer Flip-Flop-Schaltung werden Transistoren als Schalter benutzt, um zwischen zwei stabilen Zuständen hin- und herzuschalten. Die Flip-Flop-Schaltung spielt in der Digitaltechnik als integriertes Bauelement in Speicherschaltkreisen eine besonders bedeutsame Rolle.
Bei einer Flip-Flop-Schaltung werden Transistoren als Schalter benutzt, um zwischen zwei stabilen Zuständen hin- und herzuschalten. Die Flip-Flop-Schaltung spielt in der Digitaltechnik als integriertes Bauelement in Speicherschaltkreisen eine besonders bedeutsame Rolle.
Aufbau und Wirkungsweise
In einer Flip-Flop-Schaltung sind zwei Transistoren so gegeneinander geschaltet, dass jeweils der Kollektor des einen Transistors mit der Basis des anderen Transistors verbunden ist (Bild 1).
Im Ausgangszustand soll durch den Transistor T1 ein Basisstrom fließen, sodass der Kollektorstromkreis von T1 eingeschaltet ist und die Lampe L1 leuchtet (roter Stromkreis in Bild 1). Der Kollektor von T1 ist mit der Basis des Transistors T2 verbunden. Bei Stromfluss durch T1 ist der Widerstand dieses Transistors sehr klein, sodass auch die Emitter-Kollektor-Spannung
an T1 sehr klein ist. Diese kleine Spannung, die gleichzeitig an der Basis von T2 anliegt, reicht nicht aus, um die Schwellenspannung von T2 zu überwinden. Der Basistrom von T2 bleibt null. Der Kollektorstromkreis von T2 wird gesperrt. Der geringe Basisstrom von T1 durch die Lampe L2 reicht nicht aus, um diese Lampe zum Leuchten zu bringen.
Wird nun kurzzeitig der Schalter S geschlossen, liegt an der Basis von T2 eine größere Spannung an, die zu einem Basisstrom durch T2 führt. Damit werden der Kollektorstromkreis und die Lampe L2 eingeschaltet.
Dadurch sinkt die Spannung am Kollektor T2 auf einen sehr kleinen Wert unterhalb der Schwellenspannung. Da der Kollektor von T2 mit der Basis von T1 verbunden ist, fließt durch T1 kein Basisstrom mehr und der Kollektorstromkreis und die Lampe L1 werden ausgeschaltet. Daran ändert auch das Öffnen des Schalters S nichts mehr. Der Zustand bleibt stabil.
Erst durch Betätigen des Schalters R kippt der Zustand wieder in den Ausgangszustand zurück, der wiederum so lange stabil bleibt, bis S geschaltet wird.
Wegen dieser beiden stabilen Zustände nennt man die Flip-Flop-Schaltung auch bistabile Kippschaltung.
-
Flip-Flop-Schaltung