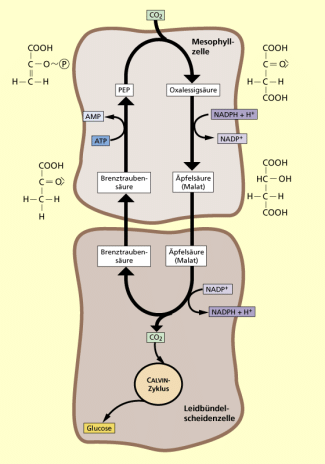Calvin-Zyklus – genauer betrachtet
Der nach dem Entdecker benannte CALVIN-Zyklus beschreibt innerhalb der Fotosynthese der Pflanzen den Weg des Kohlenstoffdioxids bis zur Entstehung eines Kohlenhydrats. Für den Ablauf der chemischen Reaktionen, die im Stroma des Chloroplasten stattfinden, werden als Voraussetzungen lediglich ATP als Energiequelle und NADPH + H+ als Reduktionsmittel benötigt. Licht ist für diesen Vorgang nicht nötig. Die komplexen Vorgänge werden in drei Phasen eingeteilt. Zunächst erfolgt die Fixierung des Kohlenstoffdioxids an einen Akzeptor (Ribulose-1,5-bisphosphat). Das erste daraus entstehende stabile Produkt ist ein Molekül mit drei Kohlenstoffatomen: Glycerinsäure-3-phosphat. Pflanzen, die auf diesem Weg Kohlenhydrate herstellen, nennt man daher C3-Pflanzen. Neben diesem Weg haben Fotosynthesespezialisten in Anpassung an trockene Umweltbedingungen Mechanismen entwickelt, Kohlenstoffdioxid in ihren Blattgeweben vorläufig zu konzentrieren.
In einer zweiten Phase erfolgt über Zwischenprodukte unter Verbrauch von ATP und mithilfe von NADPH + H+ die Reduktion der Glycerinsäure-3-phosphat zu Glycerinaldehyd-3-phosphat. Einige Moleküle dieses entstehenden Kohlenhydrats werden aus dem Kreisprozess ausgeschleust und sind die Grundlage für die Bildung weiterer Kohlenhydrate, Fette und Eiweiße u. a. zur Speicherung von Energie. Die verbleibenden Glycerinaldehyd-3-phosphat-Moleküle werden im Kreislauf zur Regeneration des Akzeptors unter nochmaligem Verbrauch von ATP verwendet.
Fotosynthetisch aktive Pflanzen zeigen auch einen Gaswechsel (Sauerstoffverbrauch und Kohlenstoffdioxidabgabe), der im Licht wesentlich aktiver abläuft als im Dunkeln und wegen seiner Ähnlichkeit zur Atmung als Lichtatmung bzw. Fotorespiration bezeichnet wird.
Ende der 40er-Jahre verfolgten CALVIN und seine Mitarbeiter, wie aus radioaktiv markiertem Kohlenstoffdioxid in einem Kreisprozess Kohlenhydrate hergestellt wurden. Der nach seinem Entdecker MELVIN CALVIN (1911-1997) benannte CALVIN-Zyklus, bzw. die lichtunabhängigen Reaktionen (Dunkelreaktion) der Fotosynthese, laufen im pigmentlosen Stroma des Chloroplasten ab. Als Voraussetzungen für die Dunkelreaktion dienen ATP als Energiequelle und NADPH + H+ als Reduktionsmittel, die in den lichtabhängigen Reaktionen (Lichtreaktion der Fotosynthese) bereitgestellt worden sind. Licht ist während dieses Prozesses nicht vonnöten.
Dabei ist zu beachten, dass sechs Kohlenstoffdioxidmoleküle in den Kreislauf eingeschleust werden müssen, um zwei Moleküle des Primärprodukts Glycerinaldehyd-3-phosphat für eine weitere Verwertung zu Glucose und anderen organischen Stoffen herzustellen.
Die ablaufenden chemischen Prozesse und die entstehenden Produkte sind dabei den Vorgängen der Zellatmung ähnlich.
Die komplexen Reaktionen des CALVIN-Zyklus werden in folgende Teilprozesse unterteilt:
-
CALVIN-Zyklus
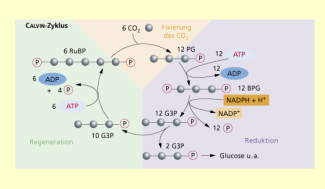
Phase 1: Fixierung des Kohlenstoffdioxids (Carboxylierungsphase)
Den Einbau des Kohlenstoffdioxids in organische Verbindungen bezeichnet man als Kohlenstoffdioxidfixierung. Ribulose-1,5-bisphosphat, ein Zuckermolekül mit fünf Kohlenstoffatomen, das durch die Anlagerung zweier Phosphatgruppen besonders energiereich ist und als Akzeptor dient, bindet Kohlenstoffdioxid. Die dabei entstehende instabile Zwischenverbindung mit sechs Kohlenstoffatomen im Molekül zerfällt sofort in zwei Moleküle 3-Phosphoglycerinsäure. Dieses Molekül mit drei Kohlenstoff-Atomen ist das erste stabile Produkt im CALVIN-Zyklus.
Pflanzen, die nur auf diesem Weg Kohlenstoffdioxid binden können, werden zu den C3-Pflanzen zusammengefasst und sind die am häufigsten vertretenen unter den Pflanzen. Neben diesem Weg können Fotosynthesespezialisten (C4-Pflanzen, CAM-Pflanzen) in Anpassung an sonnige, trockene Standorte Kohlenstoffdioxid durch andere Mechanismen vorläufig als organische Säuren binden, bevor sie dann später mithilfe des CALVIN-Zyklus Kohlenhydrate daraus herstellen.
Die Bindung des Kohlenstoffdioxids an den Akzeptor
Ribulose-1,5-bisphosphat wird durch eine Carboxylase (Rubisco) gesteuert, die vermutlich weltweit mengenmäßig das häufigste Enzym ist.
Phase 2: Reduktion
Bei der Reduktion bindet die 3-Phosphoglycerinsäure eine bei der ATP-Spaltung frei werdende Phosphatgruppe. Die entstehende 1,3-Diphosphoglycerinsäure wird durch die Elektronen des NADPH + H+ zu Glycerinaldehyd-3-phosphat (G3P) reduziert, wobei aus der Carboxylgruppe (-COOH) die energiereichere Carbonylgruppe (-CHO) entsteht. Glycerinaldehyd-3-phosphat ist ein Kohlenhydrat mit drei Kohlenstoffatomen (Triose). Zwei Moleküle Glycerinaldehyd-3-phosphat werden aus dem Kreislauf zur weiteren Verwertung entlassen, wobei über mehrere Zwischenprodukte (z. B. Fructose-1,6-diphosphat) andere organische Stoffe sowie weitere Kohlenhydrate (Glucose, Saccharose), Fette und Eiweiße u. a. zur Speicherung von Energie entstehen.
Phase 3: Regeneration des Akzeptors
Während der Regeneration des Akzeptors entsteht aus den verbleibenden Glycerinaldehyd-3-phosphat-Molekülen zunächst über mehrere Zwischenprodukte, C3-,C4-, C5- und C7-Verbindungen, Ribulose-5-phosphat. Bevor dann daraus unter Spaltung von ATP und Anlagerung einer Phosphatgruppe der Akzeptor Ribulose-1,5-bisphosphat regeneriert wird.
Die lichtunabhängigen Reaktionen lassen sich für die Bildung eines Glucosemoleküls folgendermaßen zusammenfassen:
Die Coenzyme NADP+ und ADP + P werden durch die lichtabhängigen Reaktionen wieder regeneriert, sodass sie wieder für den Ablauf des CALVIN-Zyklus zur Verfügung stehen.
Wenn man alle Prozesse der lichtabhängigen und lichtunabhängigen Reaktionen berücksichtigt, ergeben sich folgende Gesamtgleichungen :
| Bruttogleichung | ||
| Nettogleichung | ||
Dabei wird eine Energiemenge von 2 877 kJ benötigt, um ein Mol Glucose zu bilden.
Fotosynthetisch aktive Pflanzen zeigen einen zur Fotosynthese in Konkurrenz stehenden Prozess, der Lichtatmung oder Fotorespiration genannt wird. Ausgangspunkt für diesen Prozess ist die Doppelfunktion des Enzyms für die Fixierung von Kohlenstoffdioxid an den Akzeptor Ribulose-1,5-bisphosphat. Neben der Steuerung der Kohlenstoffdioxidfixierung ist es auch für die Bindung von Sauerstoff verantwortlich und wirkt als Oxygenase. Das Konzentrationsverhältnis von Sauerstoff- bzw. Kohlenstoffdioxid entscheidet über den Reaktionsverlauf.
Bei hoher Sauerstoff- aber geringer Kohlenstoffdioxidkonzentration wirkt das Enzym als Oxygenase und bindet Sauerstoff. Unter natürlichen Bedingungen (20 % , 0,03 % ) verlieren C3-Pflanzen ca. 50 % des assimilierten Kohlenstoffs, der energetisch nutzlos wieder in Kohlenstoffdioxid umgewandelt wird. Die Bedeutung dieses Prozesses ist bis heute unklar.
Bei geringem Sauerstoffgehalt im Vergleich zu hoher Kohlenstoffdioxidkonzentration überwiegt die Fixierung von Kohlenstoffdioxid, so wird die Fotorespiration gehemmt und die Nettofotosynthese steigt. Fotosynthesespezialisten (C4- und CAM-Pflanzen) zeigen im Gegensatz zu C3-Pflanzen keine Fotorespiration, da ihr Enzym für die Kohlenstofffixierung (PEP-Carboxylase) keinen Sauerstoff binden kann.
-
Fotosynthese bei C4-Pflanzen