Nationalparks
Nach § 24 (1) BNatSchG (Bundesnaturschutzgesetz) sind Nationalparks „rechtsverbindlich festgesetzte einheitlich zu schützende Gebiete, die
- großräumig und von besonderer Eigenart sind,
- im einem überwiegenden Teil ihres Gebiets die Voraussetzungen eines Naturschutzgebiets erfüllen und
- sich in einem überwiegenden Teil ihres Gebiets in einem vom Menschen nicht oder nur wenig beeinflussten Zustand befinden, oder geeignet sind, sich ein einen Zustand zu entwickeln oder in einen Zustand entwickelt zu werden, der einen möglichst ungestörten Ablauf der Naturvorgänge in ihrer natürlichen Dynamik gewährleistet.
Nationalparkdefinition der IUCN (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources)
Ein Nationalpark ist ein verhältnismäßig großes Gebiet, in dem ein oder mehrere Ökosysteme nicht wesentlich durch menschliche Nutzung oder Inanspruchnahme verändert sind und in dem Pflanzen- und Tierarten, geomorphologische Erscheinungen sowie Biotope von besonderer Bedeutung für Wissenschaft, Bildung und Erholung sind. Oder aber es handelt sich um eine besonders schöne, natürliche Landschaft, aufgrund dessen die oberste zuständige Behörde des betreffenden Staates Maßnahmen getroffen hat, im gesamten Gebiet so früh wie möglich die Nutzung oder jede andere Inanspruchnahme zu verhindern oder zu beseitigen und wirksam sicherzustellen, dass die ökologischen, geologischen, morphologischen oder ästhetischen Eigenschaften, die zur Ausweisung des Schutzgebietes geführt haben, unantastbar bleiben und in dem Besuchern unter bestimmten Bedingungen zur Erbauung, Bildung, Kulturvermittlung und Erholung Zutritt gewährt wird.
Vorrangiges Ziel der Nationalparks ist damit der Erhalt möglichst artenreicher, einheimischer Lebensgemeinschaften durch das Zulassen von natürlichen Entwicklungen und Sukzessionen ohne lenkende Eingriffe des Menschen. Wirtschaftliche Nutzungen der natürlichen Ressourcen durch Land-, Forst-, Wasserwirtschaft, Jagd oder Fischerei sind dadurch weitgehend ausgeschlossen. Soweit es der jeweilige Schutzzweck erlaubt, können Nationalparks der Allgemeinheit zugänglich gemacht und für naturnahe Erholungsformen und für Bildung erschlossen werden. Außerdem dienen sie der Naturschutzforschung.
Die deutschen Nationalparks sind weitgehend „Ziel-Nationalparks“, d.h., sie erfüllen gegenwärtig in Teilen die Kriterien für eine ungestörte Naturentwicklung. Sie sollen vielmehr durch Steuerungsmaßnahmen zu diesem Ziel hingeführt werden. Die Richtlinien der IUCN (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources) geben vor, dass mindestens 75 % der Gesamtfläche einem weitgehend naturnahen Zustand entsprechen und keiner Nutzung unterliegen dürfen, um auch international als Nationalpark anerkannt zu werden.
Die Ausweisung von Nationalparks erfolgt in Deutschland durch die Bundesländer im Benehmen mit dem Bundesumweltministerium und dem Bundesbauministerium.
Übersicht über die Nationalparks in Deutschland
Derzeit gibt es in Deutschland 14 Nationalparks mit einer Gesamtfläche von 1029496 ha:
- Nationalpark Bayerischer Wald,
- Nationalpark Berchtesgaden,
- Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer,
- Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer,
- Nationalpark Hamburgisches Wattenmeer,
- Nationalpark Jasmund,
- Nationalpark Eifel ,
- Nationalpark Sächsische Schweiz,
- Müritz Nationalpark,
- Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft,
- Nationalpark Harz,
- Nationalpark Unteres Odertal und
- Nationalpark Hainich
- Nationalpark Kellwerwand-Edersee.
Die folgende Tabelle gibt detailliertere Informationen zu den 14 Nationalparks, ihrem Gründungsjahr, ihrer Gesamtfläche in ha und den dort vorrangig geschützten Lebensräumen:
| Nationalpark (Bundesland) | Grün- dungs- jahr | Gesamt-fläche (ha) | vorrangig geschützte Lebensräume |
| Bayerischer Wald (BY) | 1970 | 24217 | Bergmischwälder, Hochlagenmischwälder, Moore, Zwergstrauchheiden |
| Berchtesgaden (BY) | 1978 | 20804 | alpine Ausprägungen von Felsen, Matten, Gebüschen, subalpine, montane und submontane Wälder, Almen, Seen |
| Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer (SH) | 1985 | 441500 davon ca. 97,7 % Wasserfläche | Wattenmeer, Salzwiesen, Polder ohne Inseln und bewohnte Halligen |
| Nieder- sächsisches Wattenmeer (NI) | 1986 | 345000 davon ca. 9 % Landfläche | Wattenmeer, Salzwiesen, Polder, Ostfriesische Inseln |
| Hamburgisches Wattenmeer (HH) | 1990 | 13750 davon ca. 3 % Landfläche | Wattenmeer im Mündungsgebiet der Elbe mit starkem Gezeiten- und Brackwassereinfluss |
| Jasmund (MV) | 1990 | 3003 davon ca. 79 % Landfläche | unterschiedliche Buchenwälder auf Kreidestandorten, Kreidesteilküste |
| Harz (ST, NI) | 1990/1994 2006 | 24700 | Hochlagen-Fichtenwälder, Buchenwälder, Moore, Bergwiesen, Block- halden und Felsformationen, Fließgewässer |
| Sächsische Schweiz (SN) | 1990 | 9350 | Fels-Wald-Komplexe, wärme- und trockenheitsliebende Wälder, Schlucht- und Schatthangwälder, submontane Wälder |
| Müritz- Nationalpark (MV) | 1990 | 32200 | Buchen-, Bruch-, Kiefernwälder, Seen und Feuchtgebiete |
| Vorpommersche Boddenlandschaft (MV) | 1990 | 80500 davon ca. 15 % Landfläche | Boddengewässer, unterschiedliche Küstenformationen und Wälder |
| Unteres Odertal (BB) | 1995 | 10323 | Flussauenlandschaft, Altarme und Altwasser, Röhricht- und Schilfbestände, Grünland, Überflutungsflächen |
| Hainich (TH) | 1997 | 7513 | Laubmisch- und Buchenwälder auf Kalkgestein in unterschiedlichen Sukzessionsstadien |
| Eifel (NRW) | 2004 | 10880 | Buchenmischwälder, Magerweiden, Nadelwälder |
| Kellerwand-Edersee (HE) | 2004 | 5724 | Rotbuchen, Eichen, Linden, Waldwiesen, Steilhänge |
Gesamtfläche mit Nord- und Ostseeflächen | 1029496 ha | (ca. 2,0 % des Bundesgebietes) | |
Gesamtfläche ohne Nord- und Ostseeflächen | 194362 ha | (ca. 0,5 % des Bundesgebietes) | |
Werden nur die Binnenlandflächen berücksichtigt, nimmt die Gesamtfläche der Nationalparks ca. 2,7 % des Bundesgebietes ein.
Bundesweit betrachtet sind weder die großen Naturräume noch die wichtigsten Großökosysteme Deutschlands vollständig durch Nationalparks geschützt. So sind folgende für Deutschland repräsentative Landschaftselemente nicht bzw. nicht ausreichend vertreten:
- Eichenwälder des Norddeutschen Tieflandes,
- Kiefern- (Eichen-) und Eichen-Hainbuchenwälder des Norddeutschen Tieflandes,
- Moorgebiete des Norddeutschen Tieflandes,
- Buchenwälder der westlichen Mittelgebirge,
- Buchenwälder der östlichen Mittelgebirge,
- Buchen- ebenso wie Eichen-Hainbuchenwälder des Schichtstufenlandes,
- Buchen- und Fichtenwälder des Schwarzwaldes und
- Wald-, Moor-, Seen- und Flussgebiete des Alpenvorlandes.
In Deutschland finden sich noch einige potenzielle Standorte für Nationalparks, die dazu beitragen könnten, diese Lücken im nationalen Schutzgebietssystem zu schließen.
Der Aufbau eines Schutzgebietssystems, das unter Berücksichtigung der Nationalparks alle für Deutschland repräsentativen Landschaften mit ihren natürlichen und naturnahen Ökosystemen umfasst, ist eine Herausforderung für Bund und Länder.
(Textauszüge, Tabelle und Grafik mit freundlicher Genehmigung des Bundesamtes für Naturschutz (BfN))
-
Karte von Deutschland mit den Nationalparks
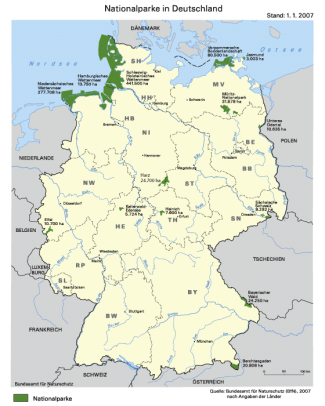
Suche nach passenden Schlagwörtern
- Nationalpark Hainich
- Müritz Nationalpark
- Nationalpark Bayerischer Wald
- Nationalpark
- Nationalpark Hamburgisches Wattenmeer
- Nationalpark Berchtesgaden
- Schutzgebietsystem
- Nationalpark Harz
- Nationalpark Unteres Odertal
- Nationalpark Jasmund
- Nationalpark Schleswig Holsteinisches Wattenmeer
- Biotope
- Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft
- Nationalpark Hochharz
- Nationalpark Sächsische Schweiz
- IUCN
- Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer

