Saurer Regen
Als Folge des steigenden Wohlstandes werden enorme Mengen an Gasen, Stäuben und Asche an die Umwelt abgegeben.
Sie reagieren mit anderen Stoffen der Atmosphäre, der Hydrosphäre bzw. der Geosphäre. Es entstehen dabei wieder Stoffe, die nun auf die belebte und unbelebte Natur einwirken. So lösen die Stoffe, die wir als Abfall betrachten, die ökologisch gesehen aber abiotische Umweltfaktoren sind, in der Natur eine Kette chemischer Reaktionen aus.
Besonders gravierend sind die Auswirkungen des Schwefeldioxids, der Oxide des Kohlenstoffs, der Oxide des Stickstoffs und verschiedener Kohlenwasserstoffe. Sie verursachen den sauren Regen und den Treibhauseffekt, führen zu Smog und sind für die Zerstörung der Ozonschicht mit verantwortlich.
Auswirkungen der Luftverschmutzung
Über die Auswirkungen auf das Leben können wir heute vielfach noch keine befriedigende Antwort geben.
Der saure Regen
Seit es auf der Erde organische Stoffe gibt, existieren die Abbauprozesse Verwesung und Fäulnis, durch die u.a. Kohlenstoffdioxid entsteht. Lebewesen scheiden als ein Reaktionsprodukt der Atmung Kohlenstoffdioxid aus. Dieses Gas geht einmal in den Kohlenstoffkreislauf ein, zum anderen reagiert es mit der Luftfeuchtigkeit und bildet Kohlensäure.
Die gewaltigen Energien eines Blitzes oxidieren den sonst außerordentlich reaktionsträgen Stickstoff der Luft. Die entstehenden Stickstoffoxide bilden mit der Luftfeuchte die Salpetersäure.
Salpetersäure und Kohlensäure sind Bestandteile des naturbedingten sauren Regens. Da er in sehr geringer Konzentration auftritt, hat er auf die belebte und unbelebte Natur kaum oder nur geringe Auswirkungen, die die Natur durch andere Prozesse neutralisiert.
Durch Menschen verursachter saurer Regen
Durch die Tätigkeit des Menschen wird der saure Regen so verstärkt, dass er zur Gefahr für die Umwelt insgesamt wird. Bei der Verbrennung fossiler Brennstoffe, wie Erdöl, Erdgas und Kohle, fällt reichlich Kohlenstoffdioxid als Bestandteil des Abgases an. Der saure Regen wird angereichert. Wegen des Schwefelgehalts in den fossilen Brennstoffen entsteht bei deren Verbrennung Schwefeldioxid in größeren Mengen. Es bildet mit der Luftfeuchtigkeit schweflige Säure.
Ein Teil des Schwefeldioxids reagiert über das Schwefeltrioxid zu Schwefelsäure.
Durch die beiden Säuren des Schwefels wird der saure Regen deutlich verstärkt.
Hinzu kommen noch die Vorgänge im Verbrennungsmotor. Der mit der Luft eingesaugte Stickstoff wird im Verbrennungsmotor oxidiert. Die entstehenden Oxide bilden mit der Feuchtigkeit der Luft Salpetersäure. Die hohe Zahl der Kraftfahrzeuge mit Verbrennungsmotoren hat einen erheblichen Anteil an der Verstärkung des sauren Regens.
Auswirkungen des sauren Regens
Durch die Oxide in Abgasen und ihre Reaktion mit der Luftfeuchtigkeit hat der Regen hat einen solch niedrigen pH-Wert erreicht, dass er auf die belebte und unbelebte Natur deutliche Auswirkungen hat. Er führt zur Versauerung des Bodens. Die Bodenbakterien besitzen keine geeigneten Lebensbedingungen mehr, sie sterben ab. Im Boden existieren aus dem Verwitterungsprozess stammende Metallverbindungen, die wegen ihrer Unlöslichkeit für das Bodenleben ohne Bedeutung waren. Durch Säuren werden diese nun in wasserlösliche Stoffe überführt und von den Pflanzen aufgenommen. Sie stören deren Stoffwechselprozesse.
-
Die Entstehung des sauren Regens
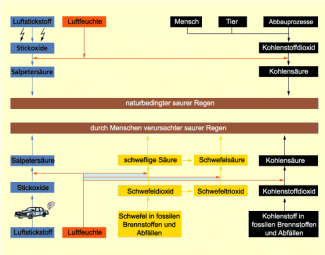
Von besonderer Bedeutung sind die Schäden im Assimilationsgewebe, die die Fotosynthese beeinträchtigen. Es können aber auch Schäden an den Wurzeln auftreten, die dann zu Störungen in der Wasser- und Nährstoffaufnahme führen. Erkennbar sind die Wirkungen des sauren Regens an Wuchsstörungen der Pflanzen, am Abwerfen von Nadeln bzw. Blättern, der Wipfeldürre und Kronenverlichtung und schließlich dem Tod der Pflanzen.
Auch an den Bauwerken der Städte und Dörfer verursacht er durch chemische Reaktionen Schäden. Carbonathaltige und damit wasserunlösliche Baumaterialien werden durch die Säuren des sauren Regens in lösliche Verbindungen überführt und vom Regenwasser weggespült. Die Bauwerke bzw. Kunstwerke verlieren zunächst ihre Konturen und später ihre Stabilität.
Metallkonstruktionen korrodieren durch den sauren Regen. Das Aussehen verändert sich, später wird die Stabilität und Festigkeit beeinträchtigt.
Gegen Korrosion geschützte Werkstoffe sind so teuer, dass sie für den allgemeinen Gebrauch nicht infrage kommen. Einziger Schutz für Brücken u.a. Metallkonstruktionen sind Farbanstriche oder Überzüge aus nicht korrodierenden Metallen (Verzinken, Verchromen).
Durch den niedrigen pH-Wert des Regens kann es auch zur Versauerung von Gewässern kommen. Da die Lebensfähigkeit der Wasserorganismen, insbesondere die der Fische, je nach Art von einem bestimmten pH-Wert abhängig ist, kommt es zur Beeinträchtigung der Wasserorganismen. Die Absenkung des pH-Wertes stellt eine mögliche Ursache dar, wenn in Gewässern ein Fischsterben registriert wird.

