Generatoren
Generatoren dienen der Umwandlung von mechanischer Energie in elektrische Energie. Dabei wird das Induktionsgesetz genutzt. Fast alle Generatoren arbeiten nach dem Rotationsprinzip: Durch ein rotierendes Magnetfeld werden in fest stehenden Induktionsspulen Spannungen induziert (Innenpolmaschine) oder in rotierenden Induktionsspulen werden durch ein fest stehendes Magnetfeld Spannungen induziert (Außenpolmaschine).
Für die Elektroenergieversorgung nutzt man zumeist sinusförmigen Wechselstrom, dessen Entstehung für den elementaren Fall der gleichförmigen Rotation einer Leiterschleife in einem homogenen Magnetfeld leicht aus dem Induktionsgesetz ableitbar ist.
Fast alle Generatoren arbeiten nach dem Rotationsprinzip, ihr Antrieb erfolgt durch eine Drehbewegung. Physikalische Grundlage aller Generatoren ist die elektromagnetische Induktion und das Induktionsgesetz.
Zur Induktion einer Spannung in einem Leiter kommt es, wenn der Leiter entweder in einem Magnetfeld bewegt wird oder der Leiter in einem veränderlichen Magnetfeld ruht. Beide Möglichkeiten für Induktionsvorgänge werden in unterschiedlichen Generatortypen angewendet.
-
Modellexperiment zum Generator: Durch Rotation eines Magneten vor Spulen wird in diesen eine Spannung induziert.

L. Meyer, Potsdam
Innenpolgeneratoren
Bei einem Innenpolgenerator rotiert ein Elektromagnet oder ein Dauermagnet in einem Hohlzylinder, an dessen Innenwänden sich die Induktionsspulen befinden. Bild 2 zeigt den prinzipiellen Aufbau eines solchen Generators. Der bewegliche Elektromagnet wird als Rotor, die ruhende Spule als Stator bezeichnet. Der Rotor besitzt bei dem dargestellten Generator vier Magnetpole, wobei jeweils Nord- und Südpol aufeinander folgen. Er muss mit Gleichstrom versorgt werden, damit sich in ihm ein zeitlich konstantes Magnetfeld aufbauen kann. Die Stromzufuhr erfolgt über Schleifkontakte. Wenn sich die Magnetpole des Rotors an den Spulenwicklungen des Stators vorbeibewegen, induzieren sie in ihnen eine Wechselspannung. Die einzelnen Teilspulen sind dabei so miteinander verschaltet, dass sich diese Spannungen überlagern und gegenseitig verstärken. An dem unbeweglichen Stator wird die induzierte Spannung an Anschlüssen abgegriffen. Das hat den Vorteil, dass man diese Induktionsspannungen ohne Schleifkontakte abgreifen kann und damit kaum Begrenzungen für die Höhe der Spannung gegeben sind. Die meisten heute genutzten Generatoren sind Innenpolgeneratoren. Sie werden auch als Innenpolmaschinen bezeichnet.
Kraftwerkgeneratoren liefern Spannung von etwa 20 kV und haben eine Leistung von bis zu 500 MW.
-
Prinzipieller Aufbau eines Innenpolgenerators
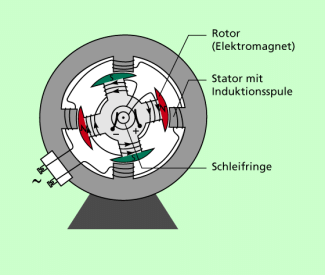
Außenpolgeneratoren
Bei einem Außenpolgenerator rotieren im zeitlich konstanten Magnetfeld des Stators Induktionsspulen. Zur Felderzeugung muss der Stator an eine Gleichspannungsquelle angeschlossen werden. Während der Drehbewegung ändert sich ständig das Magnetfeld, das die Induktionsspulen durchsetzt. Daher wird in ihnen eine Spannung induziert, die über Schleifkontakte abgegriffen werden.
Für den in Bild 3 dargestellten Fall lässt sich auch einfach zeigen, dass die induzierte Wechselspannung einen sinusförmigen Verlauf hat. Wir gehen dabei von der gleichförmigen Rotation einer Leiterschleife in einem zeitlich konstanten homogenen Magnetfeld aus. Für diesen Fall lautet das Induktionsgesetz:
Die wirksame Fläche verändert sich durch die gleichförmige Rotation der Leiterschleife ständig und nimmt Werte zwischen null und A an. Für die wirksame Fläche kann man schreiben:
Wechselstromgeneratoren und Gleichstromgeneratoren
Greift man die Spannung an den Enden einer im zeitlich konstanten homogenen Magnetfeld rotierenden Leiterschleife oder Spule direkt ab, so erhält man eine sinusförmige Wechselspannung. Ein solcher Generator wird als Wechselstromgenerator bezeichnet
Grundsätzlich eignet sich jeder Wechselstromgenerator auch als Gleichstromgenerator, sofern er mit einer Zusatzeinrichtung ausgestattet ist, die den induzierten Wechselstrom gleichrichtet. Viele Gleichstromgeneratoren sind als Außenpolmaschinen gebaut. Bei ihnen werden die Schleifkontakte zum Abgriff der Spannung aus zwei Halbschalen gebaut. Eine solche Anordnung wird als Kommutator bezeichnet, abgeleitet vom lateinischen commutare = vertauschen. Nach einer halben Umdrehung erfolgt dadurch eine Umpolung, sodass der Rotor eine pulsierende Gleichspannung abgibt, die anschließend durch Gleichrichter geglättet werden kann. Die Erzeugung von Wechselspannung ohne Kommutator und von pulsierender Gleichspannung mit einfachem Kommutator lässt sich mithilfe der Simulation veranschaulichen, die oben in der Medienleiste angegeben ist.
Energieerhaltung und Selbstinduktion
Auf den ersten Blick könnte es scheinen, als ob Generatoren überhaupt keine Energie abgeben: Schließlich muss man sie mit Gleichspannung versorgen, damit sie eine Wechselspannung erzeugen. Allerdings ist die von einem Generator gelieferte elektrische Energie weitaus größer als die elektrische Energie, die man für seinen Betrieb aufwenden muss. Dieser Zuwachs an elektrischer Energie wird durch die am Generator verrichtete mechanische Arbeit bewirkt.
Ein weiteres Problem ist mit dem Start eines Generators verknüpft. Die Gleichspannung, die zum Betrieb eines Generators notwendig ist, wird natürlich aus der im Generator selbst induzierten Wechselspannung gewonnen. Wie kann ein Generator anlaufen, wenn doch vor seiner Inbetriebnahme noch gar keine Gleichspannung für die Feldspulen vorhanden ist?
Beim Start eines Generators besitzen immer einige Bauteile, natürlich vor allem die Eisenkerne der Spulen, einen Restmagnetismus. Durch diesen Restmagnetismus (remanenter Magnetismus) wird zunächst eine kleine Spannung induziert, die ihrerseits nun allmählich eine stärkeres Magnetfeld hervorruft, wodurch die Spannungsinduktion verstärkt wird. Der Generator kommt von allein in Gang, er hat sich selbst erregt. Dieses dynamoelektrische Prinzip geht auf WERNER VON SIEMENS zurück, der es 1866 fand.
Der Fahrraddynamo - ein kleiner Generator
Die wichtigsten Teile eines Fahrraddynamos sind in Bild 5 dargestellt. Ein Laufrad ist über eine Welle mit einem tonnenförmigen Permanentmagneten verbunden. Innen im Gehäuse befinden sich Induktionsspulen, die mit diesem Gehäuse fest verbunden sind. Der Permanentmagnet kann sich innerhalb dieser Spulen drehen. Aufgrund seines Aufbaus (Induktionsspulen ruhend, felderzeugender Magnet rotiert) ist ein Fahrraddynamo ein kleiner Innenpolgenerator.
Wird das Laufrad durch eine Feder an den Reifen gedrückt, so wird es bei Bewegung des Rades in Umdrehungen versetzt. Damit rotiert der Permanentmagnet vor den Spulen und führt zu einer Änderung des von den Spulen umschlossenen Magnetfeldes. Nach dem Induktionsgesetz wird dadurch in den Spulen eine Spannung induziert. Sie beträgt bei einem Fahrraddynamo bei normaler Fahrt etwa 6 V, die elektrische Leistung einige Watt. Das ist ausreichend, um den Scheinwerfer (meist Glühlampe mit 2,4 Watt Leistung) und Rücklicht (ca. 1,5 W) mit elektrischer Energie zu versorgen.
-
Aufbau eines Fahrraddynamos

L. Meyer, Potsdam
Bild 6 zeigt, wie das Magnetfeld des Permanentmagneten, der sich im Dynamo befindet, aussieht. Aus diesem Bild ist erkennbar, dass dieser Magnet nicht nur einen Nordpol und einen Südpol hat, sondern insgesamt 8 Pole. Diese Anordnung wird gewählt, um auch bei relativ geringer Drehzahl eine ausreichende Spannung in den Spulen zu induzieren.
Insgesamt wird in einem Fahrraddynamo mechanische Energie in elektrische Energie umgewandelt. Diese Energie muss durch den Radfahrer mit aufgebracht werden. Das bedeutet: Beim Fahren mit Licht muss eine größere Energie zum Bewegen des Fahrrades aufgewendet werden als beim Fahren ohne Licht.
Bei vielen Fahrrädern wird heute auf einen Dynamo verzichtet und stattdessen die Fahrradbeleuchtung mit Batterien betrieben. Das hat den Vorteil, dass die Beleuchtung auch bei einem stehenden Fahrrad in Betrieb ist.
-
Feldlinienbild des Permanentmagneten, der in einem Fahrraddynamo rotiert.

L. Meyer, Potsdam
Suche nach passenden Schlagwörtern
- Außenpolmaschine
- Innenpolmaschine
- Fahrraddynamo
- Berechnung
- Innenpolgenerator
- Außenpolgenerator
- dynamoelektrisches Prinzip
- Magnetfeld eines Permanentmagneten
- Rotor
- Gleichstromgenerator
- Kraftwerksgenerator
- Werner von Siemens
- Generatoren
- remanenter Magnetismus
- Stator
- Kommutator
- Rechenbeispiel
- Elektromagnetische Induktion
- Restmagnetismus
- sinusförmige Wechselspannung
- Wechselstromgenerator
- Induktionsgesetz

