Entscheidungsverfahren und Beschlussfassung in der EU
Die Mitgliedstaaten der Union haben Souveränität an die EU abgegeben. Sie haben den Organen der EU die Kompetenz verliehen, in bestimmten Bereichen verbindliche Entscheidungen für die Unionsbürger und die Mitgliedstaaten zu treffen. Hierfür bedürfen sie in jedem einzelnen Fall einer ausdrücklichen Kompetenzzuweisung in den Gründungsverträgen und müssen sich an die jeweils vorgeschriebene Form des Rechtsaktes halten. Es gibt eine Vielzahl verschiedener Entscheidungsgegenstände und Entscheidungsverfahren für die drei Säulen der Europäischen Union. Im Rahmen der Europäischen Gemeinschaft ist das Rechtsetzungssystem von einem Zusammenwirken zwischen Kommission, Rat und Parlament bestimmt, wobei der Rat den Hauptgesetzgeber darstellt.
Rechtsetzung in der EU
Die Macht der EU-Mitgliedstaaten, Recht zu setzen und jederzeit alles bestehende Recht abändern zu können, ist in bestimmten Bereichen begrenzt.
Dafür verfügen die Organe der EU über die Kompetenz, selbst in diesen Bereichen Recht zu setzen. Sie treffen verbindliche Entscheidungen für die Unionsbürger und die Mitgliedstaaten.
Hierfür bedürfen sie aber in jedem einzelnen Fall einer ausdrücklichen Kompetenzzuweisung in den Gründungsverträgen und müssen zudem die jeweils vorgeschriebene Form des Rechtsaktes verwenden (Art. 249 EGV, Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung). Dieser Grundsatz wird allerdings durch die Ermächtigung des Rates zur Vertragslückenschließung (Art. 308 EGV) gelockert, der einstimmig die geeigneten Vorschriften erlässt, wenn ein Tätigwerden der Gemeinschaft erforderlich erscheint, um im Rahmen des gemeinsamen Marktes eines ihrer Ziele zu verwirklichen, im EGV die hierfür erforderlichen Befugnisse aber nicht vorgesehen sind.
Die Entscheidungsverfahren der EU variieren je nachdem, ob sie sich
- auf die Europäischen Gemeinschaften (EG, 1. Säule),
- die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik (GASP, 2. Säule) oder
- die polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen (PJZS, 3. Säule)
beziehen. Sie variieren aber auch innerhalb einzelner Politikbereiche.
Beschlussfassung der Organe
Besonders wichtig ist die Rechtsetzung der Europäischen Gemeinschaft, die für die Mitgliedstaaten und die Unionsbürger verbindlich ist. Sie obliegt dem Rat, der Kommission und dem Europäischen Parlament.
Das Europäische Parlament beschließt in der Regel mit absoluter Mehrheit der abgegebenen Stimmen. In bestimmten Fällen beschließt es aber auch
- mit einem Viertel seiner Mitglieder, mit absoluter Mehrheit der Mitglieder oder
- mit Zwei-Drittel-Mehrheit der Anwesenden und Mehrheit der Mitglieder (im Falle eines Misstrauensantrags gegen die Kommission gemäß Art. 201 EGV).
Der Rat verfügt ebenso wie das Parlament über eine Vielzahl von Möglichkeiten der Beschlussfassung. Auch seine Abstimmungen finden je nach Wichtigkeit mit verschiedenen Mehrheitsanforderungen statt.
Für die Beschlussfassung des Rates genügt im Regelfall die einfache Stimmenmehrheit bei einer Stimme pro Mitgliedstaat.
Aber für eine Reihe wichtiger Bestimmungen wird eine qualifizierte Mehrheit erforderlich. Hierbei werden die Stimmen der Mitglieder entsprechend ihrer Größe gewichtet. Die Gewichtung der Stimmen führt immer wieder zu Kontroversen, da sie die kleineren Mitgliedstaaten bevorzugt. Die Stimmenverteilung soll sich nach der Bevölkerungszahl des jeweiligen Landes richten, gleichzeitig jedoch einen Ausgleich zwischen großen und kleinen Ländern schaffen, damit die Kleinen nicht von den Großen dominiert werden. Dies führt dann allerdings zu einem Repräsentationsproblem. Bis zum Inkrafttreten des Vertrages von Nizza gab es pro Mitgliedstaat zwischen zwei und zehn Stimmen. Damit repräsentierte
- eine deutsche Stimme ca. 8 Mio. Einwohner,
- eine Luxemburger Stimme aber nur ca. 200 000 Einwohner.
Um dieses Repräsentationsproblem zu entschärfen, wurden mit dem Vertrag von Nizza die Stimmen neu gewichtet. Er sieht vor, dass es bei 27 Mitgliedern insgesamt 345 Stimmen gibt.
- Die vier großen Länder
–Deutschland,
–Frankreich,
–Vereinigtes Königreich und
–Italien
erhalten je 29 Stimmen, - Spanien und Polen 27 Stimmen.
Die anderen Länder bekommen abgestuft weniger Stimmen:
- Rumänien 14,
- die Niederlande 13,
- Griechenland, Tschechische Republik, Belgien, Ungarn und Portugal 12,
- Schweden, Bulgarien und Österreich 10,
- Dänemark, Finnland, Irland und Litauen je 7,
- Lettland, Slowenien, Estland, Zypern und Luxemburg 4 und schließlich
- Malta 3 Stimmen.
Die Stimmen wurden nach wie vor zugunsten der Kleinen gewichtet, aber die Repräsentationsunterschiede wurden verringert.
- Eine deutsche Stimme repräsentiert dann z. B. nur noch ca. 2,8 Mio. Bürger, während
- eine luxemburgische Stimme für ca. 108 000 Bürger steht.
Künftig sind für eine qualifizierte Mehrheit im Rat in einer auf 27 Staaten erweiterten EU 255 von insgesamt 345 Stimmen nötig. Eine Sperrminorität liegt bei 88 Stimmen. Drei große Staaten und ein kleines Land können eine Entscheidung verhindern. Die zwölf Beitrittsländer können zwar allein nichts durchsetzen, erhalten aber genügend Stimmen, um mit dem Drohpotenzial einer Blockade mehr Umverteilung zu erreichen. Daneben muss mindestens die Hälfte der Mitgliedstaaten dem Beschluss zustimmen. Zusätzlich muss die qualifizierte Mehrheit mindestens 62 % der Gesamtbevölkerung der Union entsprechen. Dies wird aber nur auf Antrag überprüft.
In den wichtigsten Politikbereichen ist ein einstimmiger Beschluss des Rates erforderlich. In diesen Bereichen kann damit jeder Staat sein Veto einlegen. In einer EU der 27 können einstimmige Entscheidungen unüberwindbare Hürden darstellen. Beim Gipfel von Nizza wurde daher versucht, möglichst viele strittige Themen künftig mit qualifizierter Mehrheit zu klären. Bei kontrovers diskutierten Themen wie
- der Steuerpolitik,
- den Sozialvorschriften und
- der Asyl- und Einwanderungspolitik
bleibt es beim Erfordernis der Einstimmigkeit. Mehrheitsbeschlüsse können zudem durch den Luxemburger Kompromiss ausgehebelt werden, da einzelne Mitgliedstaaten Einstimmigkeit verlangen können, wenn sie ein wichtiges nationales Interesse erklären.
Gegenstand der Rechtsetzung
Gegenstand der Rechtsetzung sind insbesondere
- Verordnungen,
- Richtlinien, und
- Entscheidungen (Art. 249 EGV),
so genanntes „sekundäres Gemeinschaftsrecht“. Richtlinien stellen eine politische Forderung der Gemeinschaft auf, die von den Parlamenten der Mitgliedstaaten innerhalb einer gesetzten Frist in nationales Recht umgesetzt werden muss. Die Art und Weise der Umsetzung überlässt sie dem Mitgliedstaat, an den sie gerichtet ist. Verordnungen gelten sofort und unmittelbar in allen Mitgliedstaaten. Die Entscheidung ist „in allen Teilen für diejenigen verbindlich, den sie bezeichnet“ (Art. 249 Abs. 4 EGV). Sie regelt stets einen Einzelfall. Adressat einer Entscheidung kann neben den Mitgliedstaaten auch eine natürliche oder juristische Person sein. Daneben zählt Art. 249 EGV noch Empfehlungen und Stellungnahmen auf. Diese sind zwar unverbindlich, haben aber eine nicht zu unterschätzende politische Bedeutung und werden oft freiwillig befolgt.
-
Mitentscheidungsverfahren
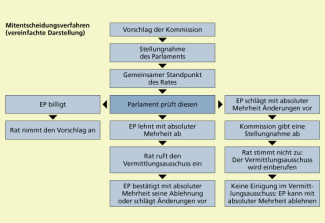
Rechtsetzungsverfahren
Die Rechtsetzung erfolgt in drei Stufen. Das Initiativrecht liegt bei der Kommission, die anschließende Beratung beim EP und beim Rat, sowie die abschließende Entscheidung beim Rat. In Einzelfällen sind Rat und Kommission allein befugt, Normen oder Einzelmaßnahmen zu beschließen. Das Parlament wird je nach Vertragsgrundlage in den Gesetzgebungsprozess eingebunden. Hauptgesetzgeber ist der Rat. Das Europäische Parlament hat sich aber mit jeder Vertragsrevision mehr Mitentscheidungsrechte bei der Rechtsetzung erkämpft.
Unterschieden werden
- das Anhörungsverfahren,
- das Verfahren der Zusammenarbeit,
- das Verfahren der Mitentscheidung und
- das Verfahren der Zustimmung.
Das Anhörungsverfahren (z. B. Art. 37 Abs. 2 EGV) beginnt mit einem Vorschlag der Kommission. Dieser wird dem Europäischen Parlament und dem Wirtschafts- und Sozialausschuss zur Stellungnahme zugeleitet, bevor der Rat endgültig entscheidet. Die Anhörung ist die schwächste Form der Beteiligung des Parlaments, da der Rat zwar die Meinung des Parlaments einholen muss, an diese aber in keiner Weise gebunden ist. Wenn die Anhörung jedoch unterbleibt, führt dies als wesentlicher Verfahrensmangel zur Nichtigkeit des Rechtsakts. Das EP hat hier die Möglichkeit, bei eilbedürftigen Entscheidungen durch eine verspätete Stellungnahme Druck auszuüben, um seine Wünsche durchzusetzen. Wenn der vom Rat endgültig verabschiedete Text im Ganzen von demjenigen abweicht, zu dem das Parlament bereits gehört wurde, muss es erneut gehört werden, wenn die Abweichung nicht seinem geäußerten Wunsch entspricht. Will der Rat vom Vorschlag der Kommission abweichen, so kann er dies nur einstimmig tun. Um die Stellung des Parlaments zu stärken, wurde durch eine gemeinsame Erklärung von Rat, Kommission und Parlament ein Konzertierungsverfahren eingeführt. Hierbei handelt es sich um ein vertraglich nicht geregeltes Einigungsverfahren zwischen
- EP,
- Kommission und
- Rat.
Das Verfahren wird in den Bereichen Steuern, Handel, Agrarpolitik, Justiz und Innenpolitik angewandt.
Das durch die Einheitliche Europäische Akte eingeführte Verfahren der Zusammenarbeit (Art. 252 EGV) sieht
- zwei Lesungen im Rat und
- zwei Lesungen im Parlament
vor. Die Kommission legt zunächst einen Vorschlag für eine Verordnung oder Richtlinie vor. Das Parlament nimmt hierzu Stellung und der Rat trifft eine Entscheidung über den so genannten gemeinsamen Standpunkt. Dieser kommt dann zu einer zweiten Lesung ins Parlament. Das Parlament hat dann innerhalb einer Dreimonatsfrist die Möglichkeit, entweder den gemeinsamen Standpunkt zu billigen, oder sich nicht zu äußern. Dann kann der Rat den gemeinsamen Standpunkt in zweiter Lesung mit qualifizierter Mehrheit annehmen. Das Parlament kann ihn aber auch mit der Mehrheit seiner Abgeordneten ablehnen. Dann muss der Rat sich einstimmig und im Einvernehmen mit der Kommission über das Votum des Parlaments hinwegsetzen. Als dritte Möglichkeit kann das EP mit der Mehrheit der Abgeordneten Änderungen vorschlagen. Dann ist wieder die Kommission am Zug und der Rat entscheidet gegebenenfalls neu. Nach dem Amsterdamer Vertrag findet das Verfahren der Zusammenarbeit nur noch im Bereich der Wirtschafts- und Währungsunion Anwendung und spielt eine untergeordnete Rolle.
Durch den Vertrag von Maastricht wurde das Mitentscheidungsverfahren (Art. 251 EGV, Bild 1, siehe PDF "Mitentscheidungsverfahren") eingeführt. Das Recht auf Mitentscheidung stellt eine der wichtigsten Befugnisse des Europäischen Parlaments dar, wobei das Parlament und der Rat gleichberechtigt sind. Ohne die Zustimmung des Parlaments kann ein Rechtsakt nicht erlassen werden. Durch die Mitentscheidung ist sichergestellt, dass die Volksvertretung der Union ein entscheidendes Wort mitspricht.
Das Mitentscheidungsverfahren sieht
- bis zu drei Lesungen und auch
- einen Vermittlungsausschuss
vor. Der Kommissionsentwurf wird dem Parlament zur Stellungnahme und dem Rat zugestellt. Stimmen nach der ersten Lesung Parlament und Rat überein, erlässt der Rat den Rechtsakt. Verlangt das EP Änderungen, kann der Rat diese billigen und den Rechtsakt dann erlassen. Wenn das nicht der Fall ist, legt der Rat einen „gemeinsamen Standpunkt“ fest. Das EP hat dann drei Monate Zeit, um eine zweite Lesung durchzuführen. Billigt das EP den gemeinsamen Standpunkt, oder fasst es keinen Beschluss, so gilt der Rechtsakt als erlassen. Lehnt das EP den gemeinsamen Standpunkt mit absoluter Mehrheit ab, so gilt der Rechtsakt als nicht erlassen. Das Verfahren ist damit beendet. Das EP kann aber auch mit absoluter Mehrheit Änderungen vorschlagen und diese Rat und Kommission zuleiten.
Billigt der Rat diese Änderungen mit absoluter Mehrheit, gilt der Rechtsakt als erlassen. Hat die Kommission die Änderungen abgelehnt, muss der Rat hierfür einstimmig beschließen. Billigt der Rat nicht alle Änderungen, wird ein „Vermittlungsausschuss“ einberufen, der je zur Hälfte aus Vertretern des Parlaments und des Rates besteht. Auf der Grundlage des vom Parlament geänderten Textes versucht der Vermittlungsausschuss innerhalb von sechs Wochen einen „gemeinsamen Entwurf“ zu finden. Wird im Vermittlungsausschuss ein gemeinsames Ergebnis gefunden, kann dieses durch eine qualifizierte Mehrheit im Rat und der Mehrheit der abgegebenen Stimmen im EP bestätigt werden. Ansonsten ist der Rechtsakt gescheitert. Der EG-Vertrag schreibt das Verfahren der Mitentscheidung für die meisten Politikbereiche vor. Es gilt z. B. für die Bereiche
- Freizügigkeit der Arbeitnehmer,
- Binnenmarkt,
- Forschung und technologische Entwicklung,
- Umweltschutz,
- Verbraucherschutz,
- Sozialpolitik,
- Verkehrspolitik,
- Bildung,
- Kultur und
- Gesundheit.
Wenn das Zustimmungsverfahren in den Verträgen vorgeschrieben ist, kann der Rechtsakt nur wirksam werden, wenn das Parlament zustimmt. Dies gilt für bestimmte völkerrechtliche Verträge der EU mit Drittstaaten, oder Beitrittsverträge mit neuen Mitgliedern. Häufigster Anwendungsbereich ist die Umweltpolitik sowie der Bereich Harmonisierung bzw. Angleichung von Rechtsvorschriften.
Die Verordnungen, Richtlinien und Entscheidungen werden vom Vorsitz des Rates unterzeichnet und im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaft veröffentlicht (Art. 254 EGV). Im Falle des Mitentscheidungsverfahren werden sie zudem vom Präsidenten des Europäischen Parlaments unterzeichnet.
Im intergouvernemental geprägten Bereich der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (GASP – 2. Säule der EU) verabschiedet der Europäische Rat allgemeine Leitlinien und gemeinsame Strategien (Art. 13 EUV). Der Ministerrat ist das eigentliche Beschlussorgan. Inhaltliche Fragen beschließt er in der Regel einstimmig, Verfahrensfragen mit der Mehrheit seiner Mitglieder. In den Fällen für die eine qualifizierte Mehrheit vorgesehen ist (Art. 23 Abs. 2 EUV) ist, haben die einzelnen Mitgliedstaaten aber die Möglichkeit eines Vetos, wenn sie wichtige Gründe der nationalen Politik geltend machen.
Auch für die Entscheidungen in inhaltlichen Fragen der intergouvernementalen dritten Säule, der polizeilichen und justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen (PJZS) ist in der Regel Einstimmigkeit erforderlich. Durchführungsentscheidungen können mit doppelter qualifizierter Mehrheit und Verfahrensfragen mit einfacher Mehrheit entschieden werden. Die Mitgliedstaaten und die Kommission teilen sich das Initiativrecht, das europäische Parlament wird in bestimmten Fällen angehört.
Das Verfahren der verstärkten Zusammenarbeit (Art. 40, 43-45 EUV, 11 EGV) ermöglicht es einer Gruppe von Staaten in bestimmten Fällen ein Vorhaben zunächst alleine zu verwirklichen, wenn sie im normalen Vertragsverfahren damit gescheitert sind. Die betreffenden Mitgliedstaaten reichen einen Antrag auf Genehmigung der verstärkten Zusammenarbeit bei der Kommission ein, die diese ggf. dem Rat zur Entscheidung vorlegt. Der Rat entscheidet mit qualifizierter Mehrheit und nach Anhörung des Europäischen Parlaments. Soweit ein Bereich betroffen ist, der ein Mitentscheidungsverfahren erfordert, ist sogar die Zustimmung des Europäischen Parlaments erforderlich. Die gefassten Beschlüsse sind nur für die teilnehmenden Staaten bindend.
Vorschläge zu Änderungen der Gründungsverträge können die Regierungen der Mitgliedstaaten, oder die Kommission dem Rat vorlegen. Gibt der Rat nach Anhörung des Parlaments und gegebenenfalls der Kommission eine Stellungnahme zugunsten des Zusammentritts einer Regierungskonferenz ab,
„so wird diese vom Präsidenten des Rates einberufen, um die an den genannten Verträgen vorzunehmenden Änderungen zu vereinbaren“ (Art. 48 EUV).
Die Änderungen treten in Kraft, nachdem sie von allen Mitgliedstaaten ratifiziert worden sind.
Ausblick
Neben den näher beschriebenen Entscheidungsverfahren gibt es z. B. noch das Verfahren zur Feststellung des Haushalts, das Verfahren zum Abschluss von Abkommen mit Drittstaaten, das Verfahren der offenen Koordinierung und eigene Entscheidungen der Kommission. Insgesamt gibt es rund 30 Entscheidungsverfahren. Das Nebeneinander einer Vielzahl von Entscheidungsverfahren und Rechtsinstrumenten macht das System sehr unübersichtlich.
Zur Vereinfachung der vielfältigen Rechtsakte und Verfahren hatte der Konvent im Rahmen der Ausarbeitung des Verfassungsentwurfs daher eine eigene Arbeitgruppe eingerichtet.
Nach dem Vertrag von Lissabon wird die Beschlussfassung im Rat – wie auch im Verfassungsentwurf vorgesehen – nach dem Prinzip der doppelten Mehrheit stattfinden. Für die doppelte Mehrheit sind die Stimmen von 55 Prozent der Mitgliedstaaten, die mindestens 65 Prozent der EU-Bürger repräsentieren, erforderlich. Das Verfahren der qualifizierten Mehrheit wurde bis November 2014 verlängert und kann im Einzelfall auch noch bis März 2017 angewandt werden. Ebenfalls bis März 2017 gilt die Bildung einer Sperrminorität (drei Viertel der Mitgliedstaaten oder der EU-Bevölkerung), um die Annahme eines Rechtsaktes durch den Rat temporär zu verhindern. Ab 2017 gilt dann eine Regel mit geänderten Prozentzahlen (ab dann 55 Prozent der Mitgliedstaaten oder EU-Bürger).
Erweiterte Befugnisse erhält das Europäische Parlament. Durch die Anwendung des Mitentscheidungsverfahrens als Regelverfahren sind Parlament und Rat gleichberechtigte Gesetzgeber.

