Gebiete des Rechts im modernen Staat
In einem modernen demokratischen Rechtsstaat wie der Bundesrepublik Deutschland werden die vielfältigen Lebensbereiche durch das Recht geordnet und gesteuert. Entsprechend sind verschiedene Gebiete des Rechts zu unterscheiden.
Rechtliche Regelungen betreffen den Bereich des öffentlichen Rechts und des Privatrechts (auch Zivilrecht genannt).
In der Bundesrepublik Deutschland baut die Organisation und Zuständigkeit der Gerichte auf der Unterscheidung von öffentlichem Recht und Privatrecht auf. Privatrechtliche (bürgerliche) Streitigkeiten werden von den Zivilgerichten der so genannten Ordentlichen Gerichtsbarkeit und den Arbeitsgerichten verhandelt, öffentlich-rechtliche Streitigkeiten vorwiegend von Verfassungs- und Verwaltungsgerichten, Finanz- und Sozialgerichten.
Wichtigste Rechtsgebiete | |
| des öffentlichen Rechts | des privaten Rechts |
|
|
| |
Das öffentliche Recht regelt
- das Verhältnis zwischen Staat und Staatsbürgern sowie
- die Beziehungen zwischen den Trägern öffentlicher Gewalt (z. B. zwischen Bund und Ländern), aber auch
- die Beziehungen zwischen Staaten (Völkerrecht).
Es zielt auf die Steuerung des staatlichen Handelns zum Allgemeinwohl und auf den Schutz des Bürgers vor staatlichem Machtmissbrauch. Gekennzeichnet ist das öffentliche Recht durch die Anordnungsgewalt des Staates in Form von Gesetzen und Verwaltungsakten, aber auch durch die Bindung aller staatlichen Gewalten
- an Grundrechte,
- Verfassung und
- rechtsstaatliche Verfahren.
Öffentlich-rechtliches Handeln braucht eine klare und konkrete gesetzliche Grundlage.
Rechtsquellen des öffentlichen Rechts sind:
- die Verfassung,
- Gesetze,
- Rechtsverordnungen,
- Verwaltungsvorschriften,
- Satzungen,
- Gewohnheits- und Richterrecht, aber auch
- staats- und verwaltungsrechtliche Verträge (z. B. völkerrechtliche Verträge zwischen Staaten).
Zum Bereich des öffentlichen Rechts gehören auch Anordnungen und Verbote staatlicher Instanzen wie
- Bewilligungen von Sozialhilfe,
- Erhebung von Steuern,
- Einberufung zur Bundeswehr,
- Schul- und Meldepflicht.
Beispiele:
| Art des Rechts | Regelungsbereich |
| Verfassungs- und Staatsrecht | Organisation des Staates, Grundlagen des Verhältnisses zwischen Staat und Bürger (Verfassung, staatsrechtliche Regelungen, z. B. Wahlrecht für den Bundestag) |
Verwaltung- srecht | Handeln der öffentlichen Verwaltung: Ordnungshandeln (z. B. Polizei), Leistungshandeln (z. B. Daseinsvorsorge wie Bildung und Infrastruktur), Planungshandeln (z. B. Stadtentwicklung) |
| Steuerrecht | Steuerarten, Grundsätze der Erhebung von Steuern und Verteilung des Steueraufkommens auf Bund, Länder und Gemeinden; besondere rechtliche Regelungen für die verschiedenen Arten von Steuern (z. B. Einkommenssteuer, Mineralölsteuer) |
| Sozialrecht | Sicherung der individuellen Existenz und Arbeitskraft, sozialer Ausgleich und Umverteilung materieller Güter, z. B. Rechte der sozialen Sicherung (Renten-, Kranken-, Arbeitslosenversicherung) und andere staatliche Leistungsbereiche (z. B. Arbeitsförderung, Berufsbildungsförderung) |
| Strafrecht | Schutz der wichtigen Rechtsgüter, die für das friedliche Zusammenleben der Menschen unentbehrlich sind (Sicherheit, Freiheit, sozialer Frieden); Androhung und Verhängung von Strafen bei Handlungen, die diese Rechtsgüter schädigen (Straftaten) |
Privatrecht
Das Privatrecht (Zivilrecht) regelt die Rechtsbeziehungen der einzelnen Bürger und der privatrechtlichen Verbände und Gesellschaften untereinander, z. B. zwischen
- Vermieter und Mieter,
- Verkäufer und Käufer,
- Arbeitgeber und Arbeitnehmer.
Die Beteiligten sind rechtlich gleichrangige Rechtssubjekte, d. h. sie haben die gleichen Rechte und Pflichten.
Der Begriff Privatrecht (abgeleitet aus lat. „privatus“) bedeutet sinngemäß „nicht öffentlich“, „für sich stehend“. Es ist aber kein von Privatpersonen geschaffenes Recht und betrifft auch nicht nur den privaten Lebensbereich des Menschen. Vielmehr handelt es sich um staatlich geschaffenes Recht, das Wertentscheidungen über die Ordnung der Gemeinschaft zum Ausdruck bringt und für das gesamte gesellschaftliche Leben von großer Bedeutung ist.
-
Bundesministerium der Justiz in Berlin

D. Ruhmke, Berlin
In Deutschland ist das Privatrecht vor allem im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) festgehalten: Es umfasst fast 2 400 Paragraphen und ist in vier Bereiche (so genannte „Bücher“) gegliedert:
- Allgemeiner Teil,
- Schuldrecht,
- Sachenrecht und
- Familienrecht.
Es gilt seit 1896, wurde aber immer wieder an die veränderten gesellschaftlichen Bedingungen angepasst, indem rechtliche Regelungen verändert oder neue Regelungen hinzugefügt wurden (z. B. im Ehe- und Familienrecht oder im Mietrecht).
Nach den Gesetzen ist das Vertragsrecht die wichtigste Rechtsquelle des Privatrechts: Die Vertragsparteien beschließen als freie Willensentscheidung in einem Vertrag das Recht, das zwischen ihnen gelten soll (Rechtsgeschäft), d. h. mindestens zwei Vertragspartner einigen sich über ihre gegenseitigen Rechte und Pflichten. Zu unterscheiden sind:
- Einzelverträge (z. B. Kaufvertrag über ein Möbelstück) und
- Kollektivverträge zwischen Gruppen und Verbänden (z. B. Tarifverträge zwischen Arbeitgeberverbänden und Gewerkschaften).
Verträge werden häufig schriftlich geschlossen, sie können aber auch auf mündlicher Vereinbarung oder schlüssigem („konkludenten“) Verhalten beruhen. Für einfache Rechtsgeschäfte mit geringem Wert (wie z. B. der Kauf eines Busfahrscheins) ist konkludentes Handeln im Normalfall eindeutig genug. Bei komplexen Rechtsgeschäften mit weitreichenden Folgen wird meist die Schriftform gewählt (z. B. Arbeitsvertrag) oder sie ist sogar gesetzlich vorgeschrieben; bestimmte Verträge müssen zusätzlich von einem Notar beglaubigt werden (z. B. Grundstücksgeschäfte).
Grundprinzip des Vertragsrechts ist die individuelle Vertragsfreiheit: Die Vertragsparteien können das Recht, das unter ihnen gelten soll, in gewissen Grenzen frei gestalten. Geschlossene Verträge sind nur dann rechtlich unwirksam, wenn sie „sittenwidrig“ sind, d. h. wenn sie das allgemeine Anstandsgefühl verletzen oder gegen die ethischen Wertmaßstäbe der Rechtsordnung verstoßen (z. B. durch arglistige Täuschung). Das öffentliche Recht geht zudem prinzipiell dem privaten Recht vor: Privatrechtliche Verträge dürfen nicht gegen die Normen des öffentlichen Rechts verstoßen.
Trennung von öffentlichem Recht und Privatrecht
In der Bundesrepublik Deutschland baut die Organisation und Zuständigkeit der Gerichte auf der Unterscheidung von öffentlichem Recht und Privatrecht auf. Privatrechtliche (bürgerliche) Streitigkeiten werden von
- den Zivilgerichten der so genannten Ordentlichen Gerichtsbarkeit und
- den Arbeitsgerichten
verhandelt, öffentlich-rechtliche Streitigkeiten vorwiegend von
- Verfassungs- und Verwaltungsgerichten,
- Finanz- und Sozialgerichten.
Öffentliches und privates Recht ist nicht immer klar abgrenzbar und nicht auf bestimmte Rechtsgebiete und Gesetze beschränkt. So ist z. B. die Regelung einer Erbschaftsstreitigkeit im privaten Recht festgehalten (Bürgerliches Gesetzbuch), aber der Ablauf des Verfahrens (Prozessrecht) ist Teil des öffentlichen Rechts. Ob es sich um privatrechtliche oder öffentlich-rechtliche Bestimmungen handelt, ist davon abhängig, wer die Beteiligten (Rechtssubjekte) in einer rechtlich geregelten Beziehung sind, und in welchem Verhältnis sie zueinander stehen.
-
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
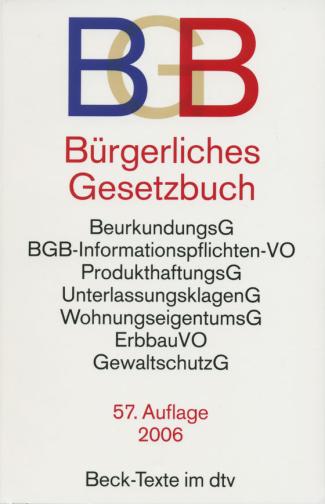
dtv

