Instrumentarien in der Politik des internationalen Handels
Die Gesamtheit aller staatlichen Maßnahmen zur Beeinflussung des grenzüberschreitenden Warenverkehrs kommt in der Außenhandelspolitik zum Ausdruck. Maßnahmen sind u. a.
- die Zollpolitik,
- die Kontingentpolitik,
- internationale Handelsabkommen und
- Handelsbeschränkungen.
Außenhandelspolitik
Die Durchführung des Außenhandels bedarf bestimmter Maßnahmen. Die Gesamtheit aller staatlichen Maßnahmen zur Beeinflussung und Regulierung des grenzüberschreitenden Güterverkehrs drückt sich in der Außenhandelspolitik aus. Maßnahmen der Außenhandelspolitik sind:
- Wirtschaftsabkommen,
- Ein- und Ausfuhrverbote,
- Exportprämien und
- die Zollpolitik.
Instrumentarien in der Politik des internationalen Handels
Instrumentarien in der Politik des internationalen Handels sind (Bild 1):
- Zölle,
- Kontingente,
- Handelsverträge,
- Dumping,
- Protektionismus,
- Freihandel.
Zölle sind an den Landesgrenzen erhobene Abgaben. Die Entrichtung von Zöllen erfolgt für die Ein-, Durch- und Ausfuhr von Waren. Man unterscheidet zwischen Ein- und Ausfuhrzöllen. Heute kommen praktisch nur noch Einfuhrzölle zur Anwendung, obwohl auch diese aufgrund des Wegfalls der innergemeinschaftlichen Zölle innerhalb der EU keine Bedeutung mehr haben. Zölle verfolgen das Ziel, entweder dem Staat Einnahmen zu bringen (Finanzzoll) oder inländische Wirtschaftszweige vor ausländischer Konkurrenz zu schützen (Schutzzoll). Dem Schutz inländischer Wirtschaftszweige dient auch die Festsetzung von Kontingenten.
Kontingente sind quantitative Limitierungen im grenzüberschreitenden Warenverkehr. Es handelt sich in der Regel um Importkontingente.
Ein wichtiges Instrument zur Beeinflussung des internationalen Handels sind Handelsverträge zwischen den Ländern. Sie sind eine Voraussetzung für die Entwicklung von Außenhandelsbeziehungen. Bei solchen Abkommen handelt es sich z. B. um die von EU-Ländern mit assoziierten AKP-Staaten (Entwicklungsländer Afrikas, der Karibik und des Pazifischen Raums) abgeschlossenen Verträge (u. a. Konventionen von Lomé I 1975 und Lomé II 1979). Diese beinhalten außer der handelspolitischen Kooperation auch eine Erlösstabilisierung für bestimmte Exportgüter der Entwicklungsländer (STA BEX-Fonds) sowie eine Zusammenarbeit im industriellen und landwirtschaftlichen Bereich.
Ein weiteres Instrument der Außenhandelspolitik ist das Dumping.
Beim Dumping wird ein Erzeugnis im Ausland zu Preisen verkauft, die unter den Produktionskosten liegen.
Von zunehmender Relevanz sind Handelshemmnisse, die Ergebnis administrativer Forderungen sind. Dabei handelt es sich u. a. um Erschwernisse im Abfertigungs- und Genehmigungsverfahren, um die Vorgabe technischer Standards, um Gesundheitszeugnisse usw.
Andere Hemmnisse des freien internationalen Güteraustausches können auch Protektionismus und Freihandel sein.
Der Protektionismus nimmt durch Zölle und Kontingente Einfluss auf den internationalen Handel. Freihandel ist ein ungehinderter internationaler Warenaustausch.
Die Idee des Freihandels
Die Idee des Freihandels ist im klassischen Wirtschaftsliberalismus vorherrschend, da die Vorzüge der Arbeitsteilung am vorteilhaftesten im freien Wettbewerb unabhängiger Produzenten und Konsumenten realisiert werden und Beeinflussungen seitens des Staates sich nur ungünstig auswirken.
Argumente gegen den Freihandel sind mit solchen Fragestellungen verbunden, ob der Freihandel zur Förderung der Produktivkräfte der Länder beiträgt und ob die Distribution des Überschusses entsprechend den Prinzipien des freien Wettbewerbs gerecht erfolgt.
Beispiel:
So kann sich das Land A auf die Produktion von Getreide und das Land B auf die Produktion elektronischer Erzeugnisse spezialisieren. Im Rahmen der Technisierung steigt zwar der Bedarf an elektronischen Erzeugnissen und die Nachfrage nach Getreide erreicht eine natürliche Grenze. Für die Arbeitsteilung führt diese Entwicklung für das Land A zu der Konsequenz, dass die Nachfrage nach seinem Exportgut sinkt, der Importbedarf nach elektronischen Produkten des Landes B jedoch ständig steigen würde. Verallgemeinert heißt das, dass langfristig die Produzenten landwirtschaftlicher Erzeugnisse gegenüber den Produzenten von Industrieerzeugnissen im internationalen Handel Nachteile erfahren, was die Entwicklung des internationalen Handels deutlich macht.
Der Bedarf an Industrieprodukten und auch deren Preise erhöhten sich wesentlich schneller als umgekehrt der Bedarf an landwirtschaftlichen Produkten und deren Preise. Langfristig kann nur eine Erhöhung der Produktivität durch Technisierung und Industrialisierung die Zunahme des Wohlstandes bewirken. Deshalb müssen alle Länder die Entwicklung der nationalen Industrie fördern. Hier tritt das Schutzzoll- bzw. Erziehungszollargument in Erscheinung.
Schutzzölle oder Importquoten bieten der nationalen Industrie Schutz vor der Konkurrenz der ausländischen Industrie.
Eine zunehmende Vereinheitlichung bewirkt eine effektive Arbeitsteilung und fortschreitende Rationalisierung. Dazu trägt die Normung bei. Sie ist eine administrative Maßnahme, die die Handelspartner zwingt, materielle wie auch immaterielle Werte einzuhalten.
-
Die Instrumentarien der Außenhandelspolitik
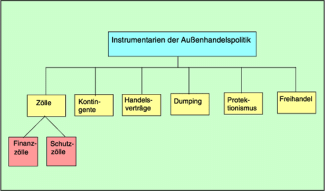
Suche nach passenden Schlagwörtern
- Erziehungszoll
- Handel
- Entwicklungsländer
- Produktivkräfte
- Handelshemmnisse
- Nachfrage
- Normung
- Zölle
- Instrumentarien
- Instrumentarien des Außenhandels
- Industrieprodukte
- Einfuhrzoll
- Außenhandel
- Dumping
- Wirtschaftsliberalismus
- Handelsverträge
- Kontingente
- Importquoten
- Bedarf
- Politik des internationalen Handels
- Außenhandelspolitik
- Schutzzoll
- landwirtschaftliche Produkte
- Protektionismus
- Arbeitsteilung
- Ausfuhrzoll
- Freihandel
- Finanzzoll

