Interessenorganisationen in Deutschland
Interessenorganisationen (Verbände) wirken nach den Parteien als wichtigste Vermittlungsinstanz zwischen Bevölkerung und Staat. Verbände nehmen nicht nur Einfluss auf die politische Willensbildung zugunsten der Verbandsmitglieder, sie sind selbst Bestandteil des politischen Systems.
In Deutschland gibt es schätzungsweise etwa 200 000 Verbände. Besonders einflussreich treten Gewerkschaften auf. Über den direkten Zugang zum Bundestag verfügen über 1 500 Verbände, die sich zuvor in einer öffentlichen Liste registrieren ließen. Interessenorganisationen sind auf allen Politikfeldern aktiv, vorzugsweise in Wirtschafts- und Finanzfragen, dann auf sozial-, kultur- und umweltpolitischen Gebieten.
Interessenorganisationen
Das Grundgesetz räumt Interessenorganisationen im Unterschied zu den Parteien (Art. 21 GG) keinen Anteil an der politischen Willensbildung ein. Real nehmen Verbände jedoch nicht nur Einfluss auf die politische Willensbildung zugunsten der Verbandsmitglieder, sie sind selbst Bestandteil des politischen Systems. Verbände entstehen auf Grundlage des Bürgerrechts aller Deutschen, „Vereine und Gesellschaften zu gründen“ (Art. 9 GG). Sie sind freiwillige, privatrechtlich nach dem Vereinsrecht des BGB organisierte Zusammenschlüsse, um
- Interessen der Mitglieder zusammenzufassen, zu organisieren und nach außen zu vertreten und
- dabei auf politische Entscheidungen Einfluß zu nehmen.
In der deutschen Monarchie galten Interessenorganisationen bis 1918 als reine gesellschaftliche Kräfte außerhalb des Staates. Die Weimarer Republik suchte sie – wenig erfolgreich – in einem „Reichswirtschaftsrat“ zusammenzufassen. Die NS-Diktatur wandelte sie in öffentliche Zwangsorganisationen um, z. B. die „Deutsche Arbeitsfront“.
Im politischen System der Bundesrepublik kann jedermann mit allen gesetzlichen Mitteln auf politische Entscheidungen Einfluss nehmen.
In Deutschland gibt es schätzungsweise etwa 200 000 Verbände. Besonders einflussreich treten Gewerkschaften auf. Über den direkten Zugang zum Bundestag verfügen über 1 500 Verbände, die sich zuvor in einer öffentlichen Liste registrieren ließen. Interessenorganisationen sind auf allen Politikfeldern aktiv, vorzugsweise in Wirtschafts- und Finanzfragen, dann auf sozial-, kultur- und umweltpolitischen Gebieten (Bild 1).
-
Adressaten und Methoden des Verbandseinflusses
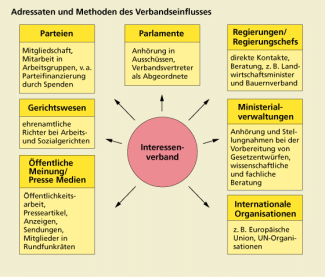
Interessenorganisationen und Politik
Verbandsvertreter verstehen sich als „Agenten“ der Mitgliederinteressen. In deren Rahmen agieren sie als autonome Initiatoren und Makler. Die wichtigsten Kontakte knüpfen Interessenvertreter formell oder informell zu:
- Bundesministerien (Verwaltung),
- Bundestagsausschüssen (Abgeordnete),
- Medien,
- Landesministerien (Verwaltung),
- Bundestagsfraktionen der Regierungsparteien (Parteien),
- Bundesministern (Minister),
- nachgeordneten Behörden (Verwaltung),
- Bundestagsfraktionen der Oppositionsparteien (Abgeordnete).
Lange wurde Lobbying (amer.: = Einflussnahme auf Abgeordnete, Mitglieder der Regierung, Verwaltung und der Gerichte) einseitig als das Einfordern von günstigen politischen Entscheidungen verstanden. Jedoch ist das Verhältnis zur Politik keine Einbahn-, sondern eine Zweibahnstraße.
Die Knappheit der Informationen über die in der Regel sehr komplizierten Sachverhalte der Gesetzgebung bringen Interessenvertreter und politische Entscheidungsträger zusammen. Beiden geht es dann um den Austausch von Informationen, Förderung, Vergünstigung und Wohlverhalten.
Die Anhörungen der Bundesministerien gelten als wichtigste Kontaktmethode. Sie finden in der Regel zu hausinternen Rohentwürfen von Gesetzen statt. Vor allem wegen der Öffentlichkeitswirkung sind auch die Anhörungen der parlamentarischen Ausschüsse bedeutsam.
Eine 1993 durchgeführte Befragung von Parlamentariern nach Verbandskontakten verwies auf die starke Rolle der Religionsgemeinschaften, die als solche nicht zu den klassischen Interessenorganisationen gerechnet werden. Auch soziokulturelle Verbände werden von Parlamentariern stark wahrgenommen. Abgeordnete mit besonderer Nähe zu einzelnen Interessenorganisationen vermitteln deutlich im Sozial- und Kulturbereich.
Staat und Parteien unterliegen nicht der „Herrschaft der Verbände“ wie auch die Interessenorganisationen nicht einem politischen Diktat unterliegen. Beide Seiten befinden sich in verschränkter Machtlage im „kooperativen Staat“. Für den demokratischen Verfassungsstaat entsteht allerdings dann ein Problem, wenn beide Seiten die verfassungsförmigen Verfahrenswege der Willensbildung und Gesetzgebung verlassen und auf dem Wege der Verhandlungen Absprachen an die Stelle von Gesetz und Verordnung treten lassen. Das Verhandlungsverfahren schließt Publikum und Opposition aus und entzieht sich damit der Öffentlichkeit und Nachprüfbarkeit.

