Stabilitätsgesetz: „Magisches Viereck“
Im Gesetz zur Förderung der Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft – kurz Stabilitätsgesetz (StWG) – sind wichtige wirtschaftspolitische Ziele und die dazu notwendigen Instrumente vorgegeben: Wirtschaftswachstum, Vollbeschäftigung, Preisstabilität und außenwirtschaftliches Gleichgewicht. Diese vier Ziele werden auch als Magisches Viereck bezeichnet. Bund und Länder haben auf gesamtgesellschaftliches Gleichgewicht zu achten, d. h. sie sollen sich antizyklisch verhalten. Die einzelnen Ziele sind durch die wechselseitige Abhängigkeit nicht gleichzeitig und vollständig erreichbar (z. B. Wirtschaftswachstum und Preisstabilität). Es existiert ein wirtschaftspolitischer Zielkonflikt. Aufgabe und Schwierigkeit der Politik besteht darin, diese Konflikte zu akzeptieren und sie auf Zeit zu lösen.
Politik ist in einer freiheitlichen Gesellschaft bestimmten übergeordneten Zielen verpflichtet, die sich an den gesellschaftlichen Grundwerten
- Freiheit,
- Gerechtigkeit,
- soziale Sicherheit und
- Persönlichkeitsentfaltung
orientieren. Die Wirtschaft ist ein – wenn auch wesentlicher – Teilbereich der Gesellschaft und Wirtschaftspolitik damit in letzter Konsequenz an diese übergeordneten Ziele gebunden. Wirtschaftspolitik soll den volkswirtschaftlichen Mechanismus entsprechend den Grundfragen nach dem „Was“, „Wie“ und „Für wen“ verbessern.
-
Das Magische Viereck
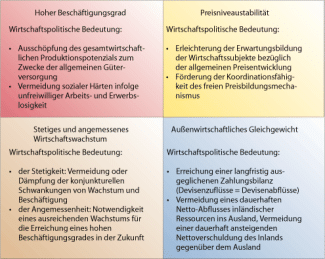
Stabilitätsgesetz
Im Gesetz zur Förderung der Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft – kurz Stabilitätsgesetz (StWG) – sind wichtige wirtschaftspolitische Ziele und die dazu notwendigen Instrumente (Mittel) vorgegeben. Bund und Länder haben auf gesamtgesellschaftliches Gleichgewicht zu achten, d. h. sie sollen sich antizyklisch verhalten. Ihre wirtschafts- und finanzpolitischen Maßnahmen müssen sie im Rahmen der marktwirtschaftlichen Ordnung gleichzeitig auf vier Ziele richten. Diese vier Ziele werden auch als Magisches Viereck bezeichnet:
- Wirtschaftswachstum wird erreicht, wenn in einer Volkswirtschaft in vergleichbaren Zeiträumen – z. B. jährlich – mehr Waren und Dienstleistungen produziert werden. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) erfasst dabei den jährlichen Geldwert dieser gesamten Produktion eines Landes. Wirtschaftswachstum wird in prozentualen Veränderungen des BIP gegenüber dem Vergleichszeitraum gemessen.
- Vollbeschäftigung bezieht sich als wirtschaftspolitisches Ziel auf den Faktor Arbeit. Als Indikator wird die Arbeitslosenquote herangezogen. Vollbeschäftigung meint aber keine Arbeitslosenquote von null Prozent. Ein Mindestmaß an Arbeitslosigkeit (Saisonarbeit, Arbeitsplatzwechsel und damit Arbeitssuche) ist weder vermeidbar noch negativ zu bewerten. Dagegen ist die hohe strukturelle Arbeitslosigkeit – häufig mit Langzeitarbeitslosigkeit verbunden –
– für die Betroffenen ein realer Abstieg,
– für die öffentlichen Haushalte eine Belastung und
– für die Gesellschaft eine Verschwendung von Ressourcen.
- Stabiles Preisniveau bezieht sich auf den Durchschnitt der Preise aller Güter und Leistungen für die private Lebenshaltung. Erhält man im z. B. im Vergleich zum Vormonat weniger für sein Geld, weil die Preise gestiegen sind (Inflation), sinkt die Kaufkraft. Umgekehrt steigt die Kaufkraft bei sinkenden Preisen (Deflation). Die Entwicklung der Kaufkraft wird über die Preisindizes für die Lebenshaltung vom Statistischen Bundesamt ermittelt.
- Außenwirtschaftliches Gleichgewicht ist durch die zunehmende internationale Verflechtung der Volkswirtschaften geprägt. Das Gewicht des Außenhandels nimmt in jeder Volkswirtschaft zu. Die Leistungsbilanz der Volkswirtschaft (gleicher Umfang von Export und Import) ist tendenziell auszugleichen. Wichtig ist, dass ein Leistungsbilanzdefizit finanzierbar bleibt.
Magisches Sechseck
Es gibt heute Auffassungen, die vier Ziele des Magischen Vierecks um zwei weitere Ziele auf ein Magisches Sechseck zu erweitern:
- Umweltschutz als wirtschaftspolitische Zielstellung soll Umweltschäden durch wirtschaftliche Tätigkeit verringern und bereits entstandene Schäden beseitigen.
- Gerechte Einkommensentwicklung ist wesentliche Voraussetzung für sozialen Frieden und damit für gesellschaftliche Stabilität. Dazu muss die Mehrheit der Bevölkerung die bestehenden Einkommensverhältnisse als sinnvoll akzeptieren.
Bisweilen wird von Autoren auch vom Magischen Siebeneck gesprochen, indem die gerechte Verteilung von Arbeit mit aufgenommen wird.
Die vier bzw. sechs oder sieben wirtschaftspolitischen Ziele existieren in einem widersprüchlichen Zusammenhang. Die einzelnen Ziele sind durch die wechselseitige Abhängigkeit der gesamtwirtschaftlichen Variablen nicht gleichzeitig und vollständig erreichbar (z. B. Wirtschaftswachstum und Preisstabilität). Es existiert ein wirtschaftspolitischer Zielkonflikt. Aufgabe und Schwierigkeit der Politik besteht darin, die Konflikte zu akzeptieren und sie auf Zeit zu lösen.
Instrumente des Stabilitätsgesetzes
Im Stabilitätsgesetz werden auch die dazu notwendigen Instrumente einer antizyklischen Wirtschaftspolitik genannt. Generell lassen sich bei den Instrumenten vier Gruppen unterscheiden:
- Informationsinstrumente (z. B. Jahreswirtschaftsbericht § 2),
- Planungsinstrumente (z. B. Pflicht zur Aufstellung von Investitionsprogrammen § 10),
- Koordinationsinstrumente (z. B. Konjunkturrat § 18),
- Eingriffsinstrumente (z. B. Anlagevorschriften für die Träger der Sozialversicherung § 30). Dazu zählen in weitem Sinn auch:
– die Maßnahmen zur Konjunkturdämpfung (z. B. Konjunkturausgleichsrücklagen, verschlechterte Abschreibungsbedingungen)
– und Konjunkturbelebung (z. B. Investitionsprogramme, Steuersenkung).
Exkurs: Europäische Dimension
Der Stabilitäts- und Wachstumspakt ist eine Ergänzung zum Maastricht-Vertrag (07.02.1992) und soll eine nachhaltige fiskalische Disziplin der Staaten der Europäischen Währungsunion (EWU) sichern. Der Pakt besteht aus
- einer Verordnung zum Aufbau eines Frühwarnsystems, das das Entstehen eines unzulässigen Haushaltdefizits eines Teilnehmerlandes verhindern soll;
- einer Verordnung, die die Sanktionen bei Vorliegen eines unzulässigen Haushaltdefizits eines Teilnehmerlandes regelt.
Entstehungsgeschichte
Am 8. Juni 1967 wurde das Stabilitätsgesetz zusammen mit einer Neufassung des Art. 109 Grundgesetz im Bundestag verabschiedet. Die wirtschaftliche Entwicklung der Bundesrepublik in der ersten Hälfte der 60er-Jahre war durch
- relativ geringe Arbeitslosigkeit,
- vergleichsweise kräftiges Wirtschaftswachstum und
- tendenziell zunehmenden Preisanstieg
geprägt. Mitte der 60er-Jahre zeichnete sich ein Konjunkturabschwung ab.
Ursprünglich war der Gesetzentwurf auf restriktive Maßnahmen gegen eine inflationär überschäumende Nachfrage gerichtet, nun mussten aber expansive Maßnahmen zur Ankurbelung der Konjunktur einbezogen werden. Das Konzept des Stabilitätsgesetzes wurde durch die Formulierung eines Zielkatalogs und die Ausrichtung der staatlichen Haushaltspolitik auf eine mittelfristig orientierte Gesamtplanung erweitert.
Kritische Stimmen
Kritik am Stabilitätsgesetz gibt es seit dem In-Kraft-Treten 1967. Viele Details werden kritisiert, so
- der unzureichende Zielkatalog (fehlende umwelt- und verteilungspolitische Ziele),
- die ordnungspolitischen Vorbehalte (Deformierung der Marktwirtschaft),
- die lückenhaften Instrumente (Steuer- und Abschreibungspraxis) und
- die unzureichende Einbeziehung der Länder und Gemeinden.
Die entscheidende Kritik richtet sich aber gegen den keynesianischen Ansatz des Gesetzes, d. h. gegen die vorrangige Belebung der gesamtgesellschaftlichen Nachfrage, die Nachfragepolitik. Die Kritiker vereint ihre Orientierung auf eine Angebotspolitik. Diese Politik beruht auf den theoretischen Ansätzen der Neoklassik und des Monetarismus und wird besonders durch MILTON FRIEDMAN repräsentiert.
Es drängt sich zunächst der Eindruck auf, als sei das Stabilitätsgesetz gleichsam in Vergessenheit geraten. Es werden zunehmend Maßnahmen ergriffen, die außerhalb des Gesetzes liegen, wenngleich sie dessen Absichten entsprechen. Regelmäßig werden die durch das Gesetz vorgesehenen Informations- und Koordinierungsinstrumente angewendet. Durch die veränderten ökonomischen Rahmenbedingungen hat sich die wirtschaftspolitische Problemsicht gewandelt. Die theoretischen Positionen haben sich deutlich zugespitzt, und das Vertrauen in die Wirksamkeit einer kurzfristig und global ausgerichteten Nachfragesteuerung mit finanzpolitischen Mitteln ist einer überwiegend ablehnenden Haltung gewichen.
Suche nach passenden Schlagwörtern
- Arbeitslosenquote
- Bruttosozialprodukt
- Inflation
- Volltext
- Konjunkturbelebung
- Import
- Faktor Arbeit
- Magisches Viereck
- Nachfragepolitik
- Kaufkraft
- Bruttoinlandsprodukt
- Instrumente des Stabilitätsgesetzes
- stabiles Preisniveau
- Konjunkturdämpfung
- Vollbeschäftigung
- Marktwirtschaftliche Ordnung
- Außenwirtschaftliches Gleichgewicht
- Deflation
- Handelsbilanz
- Preisniveaustabilität
- Stabilitäts- und Wachstumspakt
- Dokument
- Arbeit
- Angebotspolitik
- Monetarismus
- Stabilitätsgesetz
- Produktionsfaktoren
- Arbeitslosigkeit
- Umweltschutz
- gesamtgesellschaftliches Gleichgewicht
- wirtschaftspolitischer Zielkonflikt
- Wirtschaftswachstum
- gerechte Einkommensentwicklung
- Gesetzestext
- Vier Stabilitätsziele
- Wirtschaftspolitik
- Neoklassik
- Export
- Magisches Sechseck
- Quelltext

