Blütenstände, Blüte und
Teile der Blüte sind Blütenboden, Kelch-, Kron-, Staub- und Fruchtblätter. Oft sind sie zu Blütenständen vereinigt. Die Blüte ist bei den Samenpflanzen das Organ der geschlechtlichen Fortpflanzung. Die Übertragung des Blütenstaubs (Pollen) von den Staubblättern auf die Narbe eines Fruchtblatts ist die Bestäubung. Man unterscheidet Fremd- und Selbstbestäubung. Die Verschmelzung von Samenzelle und Eizelle ist die Befruchtung. Die Zwitterblüten (zweigeschlechtige Blüten) besitzen in einer Blüte weibliche (Fruchtblätter) und männliche (Staubblätter) Teile.
Eingeschlechtige Blüten enthalten nur weibliche oder nur männliche Teile. Befinden sich männliche und weibliche Blüten auf derselben Pflanze, so ist diese Pflanze einhäusig. Sind die männlichen und weiblichen Blüten getrennt auf verschiedenen Pflanzen, so ist diese Pflanze zweihäusig oder getrennt geschlechtig. Bedecktsamer besitzen Blüten, bei denen die Samenanlage vom Fruchtblatt eingeschlossen ist. Sie bilden einen Fruchtknoten. Bei den Nacktsamern liegen die Samenanlagen frei auf den Fruchtblättern des weiblichen Blütenstands (Samenschuppen).
Die Blüte und ihr Bau
Die Blüten entwickeln sich aus einem Teil der Sprossachse, die nur ein geringes Längenwachstum aufweist. Die an diesem Teil der Sprossachse vorkommenden Blätter haben sich im Verlauf der Entwicklung der Samenpflanze umgebildet. Sie unterscheiden sich deutlich von den übrigen Laubblättern.
Bei der Blüte ist die nur gering wachsende Sprossachse zum Blütenboden geworden. Aus den Blättern haben sich die meist kleinen und grünen Kelchblätter, die oft großen, farbig leuchtenden Kronblätter, die Staubblätter (männliche Teile) und ein bis viele Fruchtblätter (weibliche Teile) entwickelt.
-
Aufbau einer Blüte: Gesamtansicht
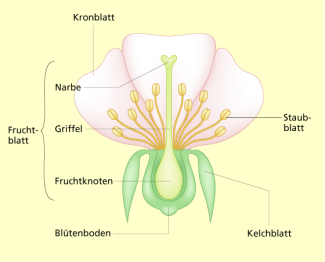
Walther-Maria Scheid
Ein Fruchtblatt besteht aus Narbe, Griffel und Fruchtknoten. Fruchtblätter sind die weiblichen Fortpflanzungsorgane. An dem langen Staubfaden des Staubblatts befindet sich ein Staubbeutel. Staubblätter sind die männlichen Fortpflanzungsorgane. Diesen Blütenaufbau findet man überwiegend bei den zweikeimblättrigen Pflanzen. Auch in den Blüten der einkeimblättrigen Pflanzen sind Staubblätter und Fruchtblätter vorhanden. Beispielsweise sind Gräser einkeimblättrige Pflanzen. Ihre kleinen Blüten (Ährchen) stehen in Blütenständen. Es gibt verschiedene Blütenstandformen, z. B. Ähre, Rispe und Ährenrispe.
-
Weibliche und männliche Teile einer Blüte
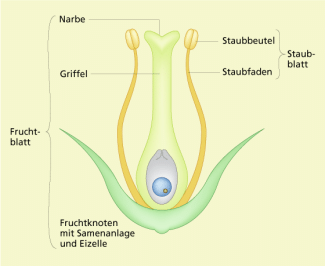
Walther-Maria Scheid
-
Teile einer Blüte der einkeimblättrigen Gräser
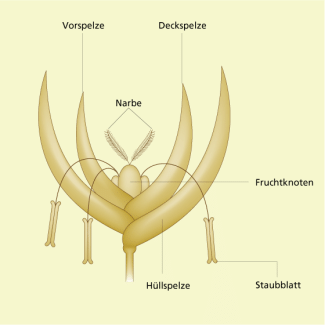
Walther-Maria Scheid
Teile der Blüte sind am Blütenboden verwachsen und werden von hier durch die Pflanze mit Nährstoffen und Wasser versorgt. Die Blüte dient der geschlechtlichen Fortpflanzung.
Vielfalt der Blüten
Es gibt eine große Vielfalt unter den Blüten. Sie sind nicht nur unterschiedlich groß, sondern unterscheiden sich auch in der Farbe und der Form. Bei manchen Pflanzenarten sind die Kronblätter miteinander verwachsen. Solche Blüten können beispielsweise trichterförmig (z. B. Petunie) oder glockenförmig (z. B. Glockenblume) sein. Beim Saatmohn und der Wildrose stehen die einzelnen Kronblätter frei auf dem Blütenboden.
Auch in der Anzahl der Kelch-, Kron-, Staub- und Fruchtblätter unterscheiden sich die Blüten verschiedener Pflanzenarten. So hat zum Beispiel die Blüte der Wildrose fünf, die Blüte des Saatmohns nur 4 Kronblätter.
Die Anzahl der Blütenteile ist ein wichtiges Merkmal, um die Pflanzen einer Pflanzengruppe, z. B. einer Pflanzenfamilie, zuzuordnen.
Die Blütenteile werden bei mehrjährigen Pflanzen meist im Verlauf eines Sommers in sehr kleiner Form ausgebildet und mit festen und vielfach klebrigen Schuppen vor den Witterungsbedingungen des Winters geschützt. Im Frühjahr brechen bei günstigem Wetter die kleinen Blütenteile aus den Knospen hervor und entfalten sich zur vollen Blütenpracht.
Geschlechtsverhältnisse bei Pflanzen
Enthält eine Blüte weibliche Teile (Fruchtblätter) und männliche Teile (Staubblätter), bezeichnet man sie als zwittrig (Zwitterblüte) oder zweigeschlechtig.
Sehr viele durch Insekten bestäubte Pflanzen haben zwittrige Blüten (zweigeschlechtige Blüten). Durch das Vorhandensein von männlichen und weiblichen Teilen in einer Blüte ist eine hohe Wahrscheinlichkeit vorhanden, dass Insekten bei Bewegungen auf der Blüte den Pollen aus den Staubblättern aufnehmen und gleichzeitig Pollen auf der Narbe hinterlassen. Die Bestäubung kann vielfach durch einen Pollen der gleichen Pflanze (Selbstbestäubung) und auch durch Pollen einer anderen Pflanze (Fremdbestäubung) erfolgen.
Enthalten Blüten nur Staubblätter bzw. Fruchtblätter, sind sie eingeschlechtig. Es sind dann entweder männliche oder weibliche Blüten.
Die Verteilung der eingeschlechtigen Blüten auf Einzelpflanzen kann unterschiedlich sein.
Trägt eine Pflanze männliche und weibliche Blüten, ist die Pflanze einhäusig (männliche und weibliche Blüten befinden sich in einem „Haus“).
Kiefer, Lärche, Hasel und Mais sind z. B. einhäusige Pflanzen.
Bei der Kiefer sitzen an den Spitzen von Maitrieben viele zapfenförmige, gelbliche Blütenstände. Darin befinden sich die männlichen Blüten. An den Spitzen anderer Maitriebe befinden sich zapfenförmige Blütenstände. Sie enthalten die weiblichen Blüten.
Einige Pflanzen besitzen nur männliche oder nur weibliche Blüten, z. B. Salweide, Eibe, Ginkgo, Sanddorn, Hopfen. Diese Pflanzen sind zweihäusig. Es gibt dann männliche Pflanzen und weibliche Pflanzen. Man sagt auch, solche Pflanzen sind getrenntgeschlechtig.
Jedes Geschlecht befindet sich auf einer eigenen Pflanze (in einem anderen Haus).
Um bei diesen Pflanzen eine geschlechtliche Fortpflanzung zu ermöglichen, müssen mindestens eine weibliche und eine männliche Pflanze in einer solchen Entfernung wachsen, dass eine Bestäubung möglich ist.
Bestäubung und Befruchtung
Zur Fortpflanzung bilden die Samenpflanzen in ihren Blüten Samenzellen (männliche Teile) und Eizellen (weibliche Teile) aus.
Die Eizellen entwickeln sich in den Fruchtblättern der Blüte. Die Eizellen haben durch die Fruchtblätter einen optimalen Schutz und eine gute Versorgung mit Nährstoffen. Die Samenzellen entstehen aus Teilen des Blütenstaubs (Pollen). Die Pollenkörner sind in den Staubbeuteln der Staubblätter gespeichert.
Da die Eizellen und die Pollen mit den Samenzellen an unterschiedlichen Stellen der Blüte gebildet werden, muss der Pollen übertragen werden. Die Übertragung des Blütenstaubs wird als Bestäubung bezeichnet. Sie kann durch Insekten, Vögel, Wasser und Wind erfolgen. Diese Form der Bestäubung wird Fremdbestäubung genannt. Manche Samenpflanzen bestäuben sich selbst. Dabei wird der Blütenstaub innerhalb der Zwitterblüte auf die eigene Narbe oder auf die Narbe weiterer Blüten derselben Pflanze übertragen. Diese Form der Bestäubung heißt Selbstbestäubung. Sie kommt z. B. bei der Kartoffel und der Erbse vor.
Nachdem die Pollenkörner auf die Narbe des Fruchtblatts gelangt sind, wächst aus jedem Pollenkorn ein Pollenschlauch durch den Griffel des Fruchtblatts. Die Pollenschläuche dringen bis zur Samenanlage mit der Eizelle vor. In jedem Pollenschlauch bilden sich zwei Samenzellen, die im Pollenschlauch bis in den Fruchtknoten gelangen. Ein Pollenschlauch gelangt bis in die Samenanlage mit der Eizelle. Aus diesem Pollenschlauch verschmilzt eine Samenzelle mit der Eizelle. Diese Eizelle ist dann befruchtet.
Entwickeln sich neue Organismen aus befruchteten Eizellen, so handelt es sich um die geschlechtliche Fortpflanzung.
Bedecktsamer und Nacktsamer
Viele Pflanzen besitzen Blüten, bei denen die Samenanlage in den Fruchtknoten des Fruchtblatts eingeschlossen ist. Diese Pflanzenarten werden zur Gruppe der Bedecktsamer zusammengefasst. Bei der Europäischen Lärche und der Gemeinen Kiefer befinden sich an den Zweigen männliche Blütenstände, die nur aus Staubblättern bestehen, und weibliche Blütenstände, die nur aus Fruchtblättern aufgebaut sind. Die Samenanlagen sind nicht von den Fruchtblättern eingeschlossen, sondern liegen frei auf den einzelnen Fruchtblättern. Pflanzenarten, deren Blüten so aufgebaut sind wie bei der Europäischen Lärche und Gemeinen Kiefer, gehören in die Gruppe der Nacktsamer.
Bei den Nacktsamern entstehen keine Früchte. Die reifen Zapfen sind die verholzten Reste des weiblichen Blütenstands. Aus den Samenanlagen entstehen Samen, die frei zwischen den Zapfenschuppen liegen. Bei der Gemeinen Kiefer dauert das Reifen der Zapfen zwei Jahre.
-
Samenanlage liegt frei auf dem Fruchtblatt (Nacktsamer).
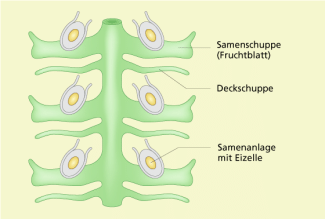
Walther-Maria Scheid
Blütenstände
Die Anzahl der Blüten, die an einer Sprossachse zu finden sind, ist unterschiedlich. Bei manchen Pflanzenarten trägt die Sprossachse nur einzeln stehende Blüten, bei anderen Pflanzenarten stehen mehrere Blüten dicht beieinander. Die Blüten bilden dann einen Blütenstand (z. B. Doppeldolde, Köpfchen, Korb oder Traube).
-
Formen einiger Blütenstände

Walther-Maria Scheid - Cornelsen Schulverlage GmbH
Suche nach passenden Schlagwörtern
- zweigeschlechtig
- Sprossachse
- Zwitterblüten
- Bestäubung
- Blüte
- Nacktsamer
- männliche Teile
- eingeschlechtig
- Blütenstandform
- zweihäusig
- geschlechtlichen Fortpflanzung
- weibliche Teile
- Kelchblätter
- Selbstbestäubung
- einkeimblättrigen Pflanzen
- Kronblätter
- einhäusig
- Blütenstände
- Staubblätter
- Fremdbestäubung
- zweikeimblättrigen Pflanzen
- Fruchtknoten
- Fruchtblätter
- Bedecktsamer

