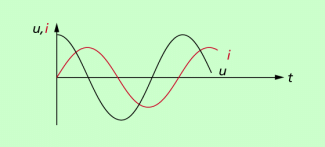Wechselstromkreis
Ein Strom, dessen Richtung sich periodisch ändert, wird als Wechselstrom bezeichnet. Dazu muss der Strom nicht unbedingt den zeitlichen Verlauf einer Sinusfunktion besitzen. Allerdings ist der sinusförmige Wechselstrom technisch am weitesten verbreitet, da er bei der Stromgewinnung in Wechselstromgeneratoren entsteht. Mit der Stromstärke ändert sich in einem Wechselstromkreis auch die Spannung periodisch. Die periodischen Verläufe von Stromstärke und Spannung können, müssen aber nicht zusammenfallen. Oft sind Strom- und Spannungsverlauf gegeneinander phasenverschoben.
Ein Strom, dessen Richtung sich periodisch ändert, wird als Wechselstrom bezeichnet. Dazu muss der Strom nicht unbedingt den zeitlichen Verlauf einer Sinusfunktion besitzen. Allerdings ist der sinusförmige Wechselstrom technisch am weitesten verbreitet, da er bei der Stromgewinnung in Wechselstromgeneratoren entsteht. Mit der Stromstärke ändert sich in einem Wechselstromkreis auch die Spannung periodisch. Die periodischen Verläufe von Stromstärke und Spannung können, müssen aber nicht zusammenfallen. Oft sind Strom- und Spannungsverlauf gegeneinander phasenverschoben.
-
Verlauf der Stromstärke im Wechselstromkreis
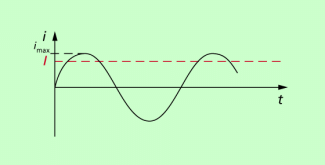
Da sich im Wechselstromkreis die Werte für Stromstärke und Spannung periodisch verändern, hat man zwischen Maximalwert (, ) und den Effektivwert (U,I) für beide Größen zu unterscheiden. Die Häufigkeit, mit der sich Stromstärke und Spannung in einer Sekunde umpolen, wird durch die Frequenz f des Wechselstromes angegeben. Die Effektivwerte für Stromstärke und Spannung kennzeichnen diejenigen Zahlenwerte, die ein Gleichstrom haben müsste, um dieselbe Leistung wie der Wechselstrom zu vollbringen. Für die Zusammenhänge zwischen Maximal- und Effektivwerten gelten die folgenden Gleichungen:
-
Verlauf der Spannung im Wechselstromkreis
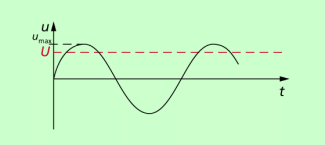
An beiden Gleichungen ist bemerkenswert, dass die Wechselstromfrequenz nicht in ihnen enthalten ist. Da die Frequenz des Wechselstromes aber zu seinen wesentlichsten Merkmalen gehört, könnte man vermuten, dass auch sie einen Einfluss auf die Effektivwerte ausübt. Diese Vermutung widerlegt man mithilfe eines Experimentes:
In einem einfachen Wechselstromkreis wird eine Glühlampe eingeschaltet. Ändert man die Frequenz des Wechselstromes, dann leuchtet die Glühlampe unverändert hell auf. An ihr wird demzufolge eine konstante Leistung umgesetzt. Da die elektrische Leistung aber nur von der Spannung und der Stromstärke abhängt, haben sich die Effektivwerte beider Größen nicht geändert. Durch das gleiche Experiment könnte man nachweisen, dass der ohmsche Widerstand der Glühlampe den zeitlichen Verlauf von Spannung und Stromstärke nicht beeinflusst.
-
Gleichphasiger Verlauf von Stromstärke und Spannung
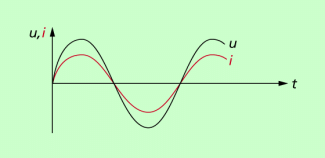
Zu einem anderen Versuchsergebnis würde man gelangen, wenn man anstatt einer Glühlampe eine Spule oder einen Kondensator in den Wechselstromkreis einschaltet. Die Induktivität bzw. die Kapazität dieser Bauteile übt einen Einfluss auf den zeitlichen Verlauf von Spannung und Stromstärke aus. Durch eine Kapazität wird ein Voreilen des Stromes gegenüber der Spannung bewirkt, durch eine Induktivität ein Nachhinken des Stromes gegenüber der Spannung. Im Idealfall beträgt die Verschiebung von Strom und Spannung genau eine Viertelperiode (im Winkelmaß: 90°).
-
Phasenverschobene Spannungs- und Stromstärkekurven