Interessensausgleich im Bundesrat
Der Bundesrat ist ein Mitwirkungsorgan im deutschen Regierungssystem, das aus den Vertretern der Regierungen der Länder besteht. Da die Entscheidungsbefugnisse im Bund nicht allein bei der Mehrheit im Bundestag und der von ihr getragenen Regierung liegen, bedarf es eines Interessensausgleiches mit den Landesregierungen im Bundesrat. Die Gesetzgebungspraxis zeigt, dass wenige Gesetze im Bundesrat scheitern, sondern dessen Mehrheit vielmehr über den Vermittlungsausschuss – der sich aus Vertretern im Bundestag und Bundesrat zusammensetzt – versucht, Gesetzesbeschlüsse der anderen parteipolitischen Mehrheit in ihrem Sinn zu verändern. Am Ende steht ein Kompromiss, der die verschiedenen Interessen ausgleicht.
Zum Begriff: Interessensausgleich im Bundesrat
Der Bundesrat (Bild 1) ist ein Mitwirkungsorgan bei der Politikgestaltung der Bundesrepublik. Die Aufgaben des Bundesrates beziehen sich auf die gesamte Staatstätigkeit des Bundes. Dabei kann es sich um eine bloße Beratung, aber auch um Alleinentscheidungen handeln, je nachdem, wie die Verfassung dies in ihren Einzelbestimmungen geregelt hat. Der Bundesrat wirkt
- bei der Gesetzgebung,
- bei der Verordnungstätigkeit und
- bei der Verwaltung des Bundes mit.
- Weiterhin wählt er die Hälfte der Bundesverfassungsrichter und kann das Bundesverfassungsgericht anrufen.
Seine wichtigste Aufgabe besteht jedoch in der Mitwirkung bei der Gesetzgebung (Art. 50 GG). Jeder Gesetzentwurf der Bundesregierung muss zunächst dem Bundesrat zur Stellungnahme vorgelegt werden, bevor er dem Bundestag zugeleitet wird (Art. 76 Abs. 2 GG). Der Bundesrat hat nun sechs Wochen Zeit, dazu Stellung zu nehmen. Die Regierungsentwürfe werden ausführlich in den Ausschüssen auf ihre verfassungsrechtliche, fachliche, finanzielle und politische Auswirkung geprüft. Häufig schlägt der Bundesrat Änderungen, Ergänzungen oder Alternativen vor. Ebenso kann es aber auch sein, dass es gar keine Einwände gibt. Dieser erste Vorgang ist ein wichtiges Zeichen für den weiteren Verlauf des Gesetzes, da es nach der Verabschiedung im Bundestag noch den Bundesrat durchlaufen muss. Hierbei kommt es darauf an, inwieweit der Bundestag die Stellungnahme des Bundesrates berücksichtigt hat.
Politisch am bedeutendsten ist das Mitwirkungsrecht des Bundesrates bei einem so genannten Zustimmungsgesetz. Zustimmungsgesetze sind
- Gesetze, die die Verfassung verändern und die Interessen der Länder besonders berühren oder aber
- Gesetze, welche von den Bundesländern auszuführen sind und die Regelungen zu Behördenorganisationen und Verwaltungsverfahren enthalten und daher nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Bundesrates verabschiedet werden können.
-
Das Gebäude des Bundesrates in der Leipziger Straße in Berlin

D. Ruhmke, Berlin
Dazu zählt zum Beispiel der Entwurf des Zuwanderungsgesetzes (Gesetzentwurf zur Steuerung und Begrenzung der Zuwanderung und zur Regelung des Aufenthaltes und der Integration von Unionsbürgern und Ausländern), der im November 2001 vom Bundeskabinett verabschiedet und dem Bundesrat zur Stellungnahme vorgelegt wurde (Bild 2). Der Gesetzentwurf basierte auf dem Bericht der von Bundesinnenminister OTTO SCHILY berufenen Zuwanderungskommission, der zum Schluss gekommen war, dass Deutschland aus Gründen des Arbeitsmarktes aber auch wegen der Überalterung der Gesellschaft Zuwanderung brauche.
Lehnt der Bundesrat ein solches Gesetz endgültig ab, ist es gescheitert. Der Bundestag darf diese Entscheidung nicht überstimmen. Bundesregierung und Bundestag können lediglich durch Anrufung des Vermittlungsausschusses einen Einigungsversuch unternehmen. Bei allen übrigen vom Bundestag beschlossenen Gesetzen besitzt der Bundesrat nur ein Einspruchsrecht. Weist der Bundestag mit absoluter Mehrheit den Einspruch zurück, kann das Gesetz verabschiedet werden. Für eine absolute Mehrheit sind derzeit bei einer Gesamtmitgliederzahl von 603 Abgeordneten 302 Stimmen erforderlich.
Da die Entscheidungsbefugnisse im Bund nicht allein bei der Mehrheit im Bundestag und der von ihr getragenen Regierung liegen, bedarf es eines Interessenausgleiches mit den Landesregierungen im Bundesrat. Aufgrund seiner verfassungsmäßigen Aufgabe, bei der Gesetzgebung des Bundes mitzuwirken, kann er den Handlungsspielraum der parlamentarischen Mehrheit im Bundestag und damit der Bundesregierung beträchtlich einschränken. Daher ist er auch ein wichtiges Instrument für die Opposition, die über eine Mehrheit im Bundesrat Gesetzesbeschlüsse verhindern kann. Gleichwohl ist der Bundesrat nicht nur von Partei- sondern auch von Landesinteressen bestimmt.
Bevor sich die Landesregierungen jedoch ihrerseits auf eine Position festlegen, steht ein Prozess der Koordinierung innerhalb jeder Landesregierung, zwischen den Landesregierungen derselben Partei, aber auch parteiübergreifend zwischen Ländern mit ähnlichen Interessen oder ähnlichen Problemen. Vor dem Interessenausgleich erfolgt also zunächst eine Positionierung der Länder.
Koordinierung innerhalb der Landeskabinette
Die Bundesratsmitglieder sind bei der Stimmabgabe an die Weisungen ihrer Landesregierung gebunden. Jedes Land verfügt grundsätzlich mindestens über drei Stimmen. Bei einer Einwohnerzahl von über zwei Millionen vier, bei über sechs Millionen fünf und bei mehr als sieben Millionen sechs Stimmen. Die Stimmenzahl aller Länder zusammen beträgt 69 Stimmen. Da die Stimmabgabe eines Bundeslandes einheitlich erfolgen muss, ist eine frühzeitige Koordinierung und Festlegung innerhalb der jeweiligen Landesregierung erforderlich. Eine solche Festlegung ist wichtig, da die Stimme sonst als ungültig und damit als Nein-Stimme gezählt wird. An jedem Montag oder Dienstag vor einer Sitzung des Bundesrates, tagen die Landeskabinette, das heißt der Ministerpräsident und die Landesminister, um ihre Haltung festzulegen.
Bei der Abstimmung über das Zuwanderungsgesetz im März 2002 (Bild 2) hatte sich die Regierung des Landes Brandenburg, bestehend aus SPD und CDU nicht auf eine Haltung festlegen können. Infolgedessen stimmte Brandenburg im Bundesrat nicht einheitlich ab. Der Bundesratspräsident wertete daraufhin nur die Stimme des Ministerpräsidenten, der mit „Ja“ abgestimmt hatte. Das Gesetz konnte aufgrund der Zustimmung der Mehrheit im Bundesrat beschlossen werden. Das Bundesverfassungsgericht erklärte jedoch auf Anrufung Hessens und weiterer unionsgeführter Länder die Zustimmung des Bundesrates im Dezember 2002 für nichtig. Das Zuwanderungsgesetz war damit zunächst gescheitert.
Parteipolitische Koordinierung der Länder
Neben der Festlegung der Abstimmungslinie im Landeskabinett treffen sich Unions- bzw. SPD-geführte Länder in Vorab-Gesprächen, um ihre Interessen zu koordinieren. Wird keine gemeinsame Abstimmungslinie gefunden, können sich die entscheidenden Verhandlungen auch auf die Ebene zwischen Ministerpräsidenten und Kanzler oder Ministerpräsidenten und Bundesoppositionsführer ein und der gleichen Partei verlagern. Obwohl es im Bundesrat keine Fraktionen wie im Bundestag gibt, überlagert auch hier in der Regel die parteipolitische Zugehörigkeit die föderative Grundausrichtung.
Bundesratsausschüsse
Da sich die Bundesratsmitglieder nicht mit sämtlichen im Bundesrat zu behandelnden Vorlagen selbst beschäftigen können, weil sie zugleich auch die Regierungen ihrer Länder bilden, findet die Entscheidungsfindung zumeist in den Bundesratsausschüssen statt. Alle Länder entsenden in jeden Ausschuss ein Mitglied und besitzen dort eine Stimme. Der Bundesrat hat derzeit 16 Ausschüsse, die sich im Wesentlichen an der Zuständigkeitsverteilung der Bundesministerien orientieren:
- Agrarausschuss
- Ausschuss für Arbeit und Sozialpolitik
- Ausschuss für Auswärtige Angelegenheiten
- Ausschuss für Fragen der Europäischen Union
- Ausschuss für Familie und Senioren
- Finanzausschuss
- Ausschuss für Frauen und Jugend
- Gesundheitsausschuss
- Ausschuss für innere Angelegenheiten
- Ausschuss für Kulturfragen
- Rechtsausschuss
- Ausschuss für Städtebau, Wohnungswesen und Raumordnung
- Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit
- Verkehrsausschuss
- Ausschuss für Verteidigung
Bei den im dreiwöchigen Turnus stattfindenden Plenarsitzungen des Bundesrates wird nur noch förmlich beschlossen. Handelt es sich jedoch um ein politisch brisantes Thema wie das Zuwanderungsgesetz, erfolgt die Entscheidungsfindung auf höchster Ebene.
Ausgleich der Interessen im Vermittlungsausschuss
Weicht die Meinung des Bundesrates von einer vom Bundestag verabschiedeten Gesetzesfassung ab, kann er innerhalb von drei Wochen den Vermittlungsausschuss anrufen. Dieser setzt sich aus je 16 Mitgliedern von Bundesrat und Bundestag zusammen. Der Vermittlungsausschuss ist seinem Selbstverständnis nach ein Hilfsorgan, das Vorschläge für einen Ausgleich der unterschiedlichen Interessen von Bundestag und Bundesrat erarbeiten soll.
Die Gesetzgebungspraxis zeigt, dass kaum Gesetze am Bundesrat scheitern, sondern dessen Mehrheit vielmehr über den Vermittlungsausschuss mit Erfolg versucht, Gesetzesbeschlüsse der anderen parteipolitischen Mehrheit in ihrem Sinn zu verändern.
Beim Beispiel des Zuwanderungsgesetzes konnte erst über den Umweg eines klärenden Gesprächs zwischen den parteipolitischen Spitzen der Regierung und Opposition im Vermittlungssausschuss ein Ausgleich der Interessen gefunden werden. Nachdem die Bundesregierung im Januar 2003 den Gesetzentwurf erneut und unverändert in das Gesetzgebungsverfahren eingebracht hatte und ihn der Bundesrat mit den Stimmen der unionsgeführten Länder im Juni 2003 ablehnte, wurde der Vermittlungssauschuss angerufen. Nachdem auch dieser zu keinem Ausgleich der Interessen führte, wurde im Oktober 2003 eine Arbeitsgruppe eingesetzt.
Da es auch hier zu keiner Lösung kam, erklärte der damalige Bundeskanzler GERHARD SCHRÖDER das Verfahren zur Chefsache. Im Mai 2004 wurden in einem Gespräch mit den Unionsvorsitzenden ANGELA MERKEL und EDMUND STOIBER Eckpunkte für eine Überarbeitung des im Vermittlungsausschuss liegenden Gesetzentwurfs vereinbart. Der Verhandlungsführer der Regierung, Bundesinnenminister OTTO SCHILY, und die Unions-Politiker GÜNTHER BECKSTEIN (Staatsminister des Innern in Bayern) und PETER MÜLLER (Ministerpräsident des Saarlandes) beschlossen die Details des Kompromisses. Der Vermittlungsausschuss billigte daraufhin den Gesetzentwurf. Der überarbeitete Entwurf wurde im Juli 2004 im Bundestag beschlossen. Der Bundesrat verabschiedete das Gesetz am 9. Juli 2004. Am 1. Januar 2005 trat das Gesetz schließlich in Kraft.
Am 28. März 2007 beschließt das Bundeskabinett die Reform des Zuwanderungsgesetzes mit dem unter anderem aufenthalts- und asylrechtliche Richtlinien der Europäischen Union in nationales Recht umgesetzt werden sollen.
-
vom Entwurf bis zur Verabschiedung des Zuwanderungsgesetzes (2001–2004)
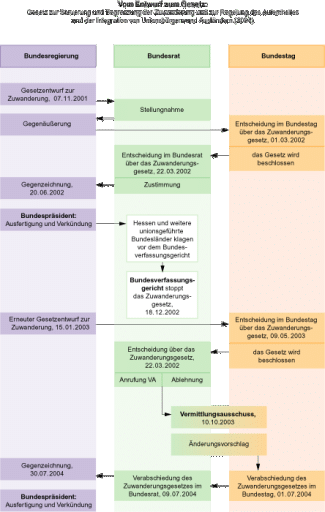
Suche nach passenden Schlagwörtern
- GÜNTHER BECKSTEIN
- Opposition
- Landesregierung
- Kompromiss
- Plenarsitzungen
- Stimmabgabe
- Zuwanderungsgesetz
- Mitwirkungsrecht
- Bundeskanzler
- Gesetzesentwurf
- Vorab-Gespräche
- Bundespräsident
- Verfassung
- Gerhard Schröder
- Ministerpräsident
- Mitwirkungsorgan
- Bundesregierung
- absolute Mehrheit
- Vermittlungsausschuss
- Interessenausgleich
- Bundesverfassungsrichter
- Bundestag
- Bundesinnenminister
- OTTO SCHILY
- Landesminister
- Regierungssystem
- Gesetzgebungsverfahren
- Zustimmungsgesetz
- Landeskabinett
- Einspruchsrecht
- Bundesratsausschüsse
- Staatsminister
- Koordinierung
- Bundesrat
- ANGELA MERKEL
- PETER MÜLLER
- Zuwanderungskommission
- Bundesverfassungsgericht

